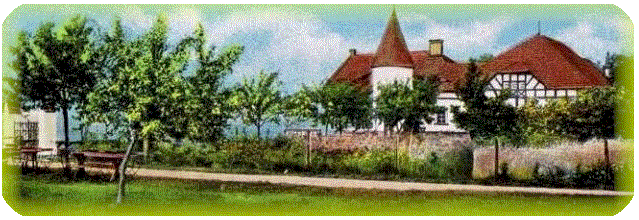
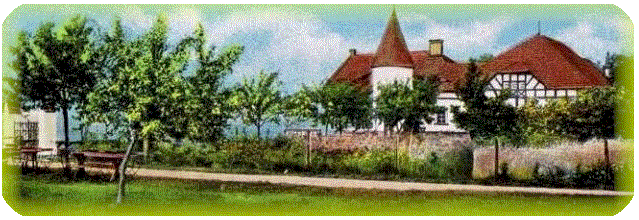
Ich will nicht, daß Emma vergessen wird. Sie war meine Großmutter mütterlicherseits. Wenn ich nicht von ihr erzähle, kann es keiner mehr. Wie Lämmerwölkchen trieb ich meine Erinnerungen an sie zu einer Herde zusammen - bis ein Bild von ihr entstand.
Emma war eine Weberstochter aus Hückeswagen, einem hübschen Städtchen im Rheinland. Der Auszug aus dem dortigen Kirchenregister der evangelischen Gemeinde bescheinigt, daß sie am 15. Januar 1858 morgens um 4.00 Uhr als erstes Kind ihrer Eltern geboren wurde. Der stolze Vater, von Beruf Tuchweber, hieß Carl Wilhelm Stieglitz. Sein Geburtsdatum bleibt unbekannt. Er stammte auch aus Hückeswagen „An den drei Bäumen“. Seine Frau, Emmas glückliche Mutter, hieß Eleonore - eine am 26. Oktober 1836 geborene Höltenhoff. Zwei befreundete Fabrikarbeiter aus dem Hückewagener Stadtgebiet traten der kleinen Emma als Paten zur Seite.
Nach mündlichen Überlieferungen wurde als zweites Kind noch ein taubstummer Junge geboren, dessen Spur sich vollkommen verlor. Nicht einmal sein Name ist bekannt. Auch die Verhältnisse im Elternhaus sind nicht mehr zu ergründen. Ich vermute, daß sie nicht üppig gewesen sind, denn damals waren Webersleute arme Leute. Ganz selten schaffte es ein Weber um 1858, in Emmas Geburtsjahr, seine Familie alleine zu ernähren. Meistens mußten Frau und Kinder mitschuften - und das 12 bis 14 Stunden täglich für einen Hungerlohn. Erst 32 Jahre später konnten die Weber nach harten Streiks endlich durchsetzen, daß man für sie den Elfstundentag einführte.
Gegen zu große Armut in der Familie spricht aber Emmas Bildung, die sie ohne Zweifel hatte. Also liegt da manches im Ungewissen. Sie sprach und schrieb ein fehlerfreies Hochdeutsch, muß also lange Zeit eine gute Schule besucht haben, und das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie schon als Kind am Webstuhl hätte stehen müssen. Ob sie in der Schule schon Turnunterricht erhielt, ist zu bezweifeln. Frauen und Mädchen wurde gerade erst erlaubt, an ganz einfachen Übungen teilzunehmen, wenn sie einen langen Rock trugen, der die Beine vollkommen verhüllte; sie durften nie hervorlugen. Man umgab die weiblichen Wesen damals noch mit einem großen Geheimnis.
In Emmas Geburtsjahr entdeckten modebewußte Damen, die auf sich hielten, plötzlich wieder die Krinoline. Das einfache Biedermeier gefiel ihnen nicht mehr. Emmas Mutter wird wohl nur eine Krinoline bescheidenen Umfangs besessen haben - mit höchstens drei Volants. Die französische Königin dagegen verbrauchte für ihr neuestes Ballkleid mit 103 Volants 450 Meter Tüll.
In Berlin übernahm 1858 der Prinz von Preußen, Wilhelm der I., die Regentschaft für seinen offensichtlich geisteskranken Bruder, König Friedrich Wilhelm den IV. Ebenfalls in diesem Jahr erschien der 14jährigen Bernadette in Lourds am Rande der Pyrenäen die Jungfrau Maria.
Emma ist sehr hübsch gewesen, wenn nicht sogar schön. Mittelgroß, rank und schlank trug sie ihre anmutige Gestalt kerzengerade. Ihre fein geformte Nase paßte vollendet zu den hoch sitzenden Wangenknochen, den hellblauen Augen und den schön geschwungenen Lippen. Das schönste an Emma war gewiß ihr prächtiges, volles kastanienbraunes Haar, das sie aufgesteckt trug und das selbst in hohem Alter nicht ergraute, sondern nur in der Farbe etwas verblaßte.
Manch begehrlicher Männerblick mag ihr gefolgt sein, wenn sie durch Hückeswagen ging. Aber Emma wartete auf einen ganz bestimmten Mann, den sie lieben würde. Und eines Tages kam er. Sie begegnete Adolf.
Adolf war auf Wanderschaft. Er kam aus Metzingen, aus dem schönen Württemberger Land. Die Spuren seiner Familiengeschichte lassen sich etwas weiter zurückverfolgen. Adolfs Großvater war der ehrenwerte Schultheiß von Oethlingen. Er hieß David Gerst und seine Ehefrau Maria Rosina geborene Bojus. Der Schultheiß war damals das Gemeindeoberhaupt, oft nannte man ihn einfach nur den Schulzen. In Reichsstädten übte der Schultheiß auch die höchste Gerichtsbarkeit aus. Nebenbei braute David Gerst Bier. Diese beiden Stände findet man in der damaligen Zeit außerordentlich oft verkoppelt. Wer Bier braute, verdiente eine Menge Geld, und Geld brachte Ansehen. Nur wer von beidem reichlich besaß, konnte Schultheiß werden. Arme Schulzen gab es nicht.
David ist schätzungsweise 1780 geboren. In diesem Jahr starb in Österreich die Erzherzogin Maria Theresia, und eine Erfindung stürzte den Stand der Weber in Angst und Schrecken: Wenige Jahre zuvor hatte man die Dampfmaschine erfunden, die nun auch in Deutschen Landen gebaut wurde, um sie in der Garn- und Tuchindustrie einzusetzen. Viele Menschenhände würden überflüssig und viele Familien damit um ihr Brot gebracht werden.
Als David sechs Jahre alt war, schloß in Sanssouci der Alte Fritz für immer die Augen - 46 Jahre hatte er Preußen regiert. David war noch nicht zehn, als in Frankreich die Revolution ausbrach und dreizehn Jahre, als der französische König und Königin Marie Antoinette öffentlich hingerichtet wurden.
Die Zeit war aufregend und verging wie im Fluge. Am 6. Juli 1823 schenkte Maria Rosina ihrem Mann David einen Sohn, den man auf den Namen Johann Wilhelm Gerst taufte. Das Biedermeier stand damals in der Hochblüte. Man kam sich ungeheuer fortschrittlich vor und besann sich endlich auf die Bildung der Frauen und Mädchen. Zu lange hatte man sie vernachlässigt - sogar für überflüssig gehalten. Jetzt entstanden überall Schulen und Pensionate für höhere Töchter. In Berlin, beim Verlag Hande & Spener wurde die erste Zeitung auf einer Schnellpresse aus Amerika gedruckt. Überhaupt - Berlin! Alle wollten nach Berlin. Die Stadt platze bald aus allen Nähten. Die ersten Mietskasernen mit mehreren Hinterhöfen entstanden, dabei war es erst hundert Jahre her, daß in dieser Stadt die letzte Hexe öffentlich verbrannt wurde. Ein Georges Everest vermaß gerade Indien, und ihm zu Ehren wurde der Mount Everest benannt.
Der junge Johann Wilhelm folgte beruflich nicht seinem Vater, wurde weder Schultheiß noch Bierbrauer, sondern erlernte das Handwerk der Tuchmacher - von der Pieke auf, wie es sich gehörte. Die Erfindung der Dampfmaschine eröffnete nun vollkommen neue Möglichkeiten in der Tuchindustrialisierung, an die früher kein Mensch gedacht hätte. Johann Wilhelm muß ein recht munterer, vitaler Bursche gewesen sein, aber auch ein Ehrenmann. Als die reiche Metzgerstochter Anna Maria Kostenbader 1846 in Metzingen vom ihm im dritten Monat schwanger war, heiratete er sie auf der Stelle. Er war 23 Jahre alt, seine Anna Maria 20. Von der Pille wußte man noch nichts, und so gebar Anna Maria in 8 Jahren sieben Kinder. Die geplagte Mutter hatte sich durch die vielen Schwangerschaften körperlich völlig verausgabt. Sie starb drei Wochen nach der Geburt ihres siebten Kindes im Alter von nur 28 Jahren. Der Witwer ließ sich den Spaß aber nicht verderben. Ein knappes Jahr später heiratete er seine zweite Frau, die Tuchmachertochter Maria Magdalena Flamm. Mit ihr zeugte er weitere zehn Kinder. 1867 schenkte sie ihm sogar zwei Sprößlinge, einen Jungen im Januar und ein Mädchen Anfang November. Die Säuglingssterblichkeit lag sehr hoch, und so blieben von den insgesamt siebzehn Kindern nur acht am Leben - aus jeder Ehe vier.
Johann Wilhelm lebte mit seiner Familie in guten finanziellen Verhältnissen und konnte in Ruhe seine acht Kinder aufziehen. Das dritte Kind aus seiner Ehe mit Anna Maria, ein Junge, war am 8. November 1849 geboren und hieß Gustav Adolf Gerst. Bestimmt lag für den kleinen Adolf, so wurde er gerufen, an irgendeinem Weihnachten das Buch vom Struwelpeter auf dem Gabentisch, denn man las viel in der Familie, und dieses Kinderbuch erfreute sich außerordentlicher Beliebtheit. Der Nervenarzt Heinrich Hoffmann hatte diese Geschichte für seinen eigenen Sohn geschrieben und illustriert, und sie wurde sofort ein Bestseller und ist es auch noch heute - nach über 150 Jahren.
Die Tänzerin Lola Montese machte 1849 gerade die gesamte männliche Welt verrückt und in Berlin wurde die Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ uraufgeführt. Der polnische Komponist Frederic Chopin starb in Paris, der Amerikaner Edgar Allan Poe starb ebenfalls. Über Amerika ergoß sich eine Schwemme von Einwanderern - der Goldrausch war ausgebrochen, der Sklavenhandel stand auf dem Höhepunkt und die Lehrerin Harriet Beecher schrieb den Roman „Onkel Toms Hütte“. Bayern gab als erstes deutsches Land eine Briefmarke heraus.
Von alledem ahnte der kleine Adolf natürlich noch nichts. Er wuchs in Ruhe in der Geborgenheit seiner Familie heran und lernte vom Vater das Geschäft der Tuchmacher. Johann Wilhelm schickte ihn, nachdem er ausgelernt hatte und er ihm nichts mehr beibringen konnte, auf die Wanderschaft - wie es damals üblich war. Adolf sollte sich den Wind der Fremde um die Nase wehen lassen und gleichzeitig die Augen aufsperren und lernen, wie das Tuch in anderen Gegenden Deutschlands gewebt wurde.
Irgendwann auf seiner Reise kam Adolf ins Rheinland nach Hückeswagen und traf die schöne Weberstochter Emma Stieglitz. Es war eine schicksalhafte Begegnung, denn sie verliebten sich ineinander und heirateten in Emmas Heimatstädtchen am 29. Mai 1879 bürgerlich und ein paar Tage später kirchlich evangelisch. Emma war Halbwaise - ihr Vater war schon lange tot. Sie war gerade 21 Jahre alt und Adolf 30. Es muß eine große Liebe gewesen sein, denn Adolf verließ seine Heimat für immer. Er hatte von nun an kaum noch Kontakte zu seinem Elternhaus - woran das lag, bleibt ein Rätsel. War Emma dem reichen Schwiegervater nicht gut genug? Sie war nur eine Weberstochter und Johann Wilhelm Gerst war Tuchmacher. Tuchmacher hatten eine Tuchfabrik, stellten auch bei anderen Leuten Webstühle auf und ließen in Heimarbeit weben, wahrscheinlich - wie es üblich war - für einen Hungerlohn.
Auch das Jahr 1879, in dem Emma und Adolf heirateten, steckte voller großer Ereignisse. Zwei bedeutende Männer kamen auf die Welt: in Frankfurt/Main der spätere Chemiker Otto Hahn und in Ulm Albert Einstein. Edison erfand die Glühfadenlampe, und der erste Duden erschien. In Rom starb der Baumeister Semper. In der Leipziger Straße in Berlin montierte man die ersten elektrischen Bogenlampen, in zwei Jahren wird die erste elektrische Straßenbahn durch die Straßen rattern und die Pferdebahnen für immer außer Betrieb setzen. Ebenfalls in Berlin prägte auch Professor Heinrich von Treitschke den verhängnisvollen Satz „Die Juden sind unser Unglück“. Eine neue Ära des Antisemitismus brach an. Die erste Zeitung der Zeugen Jehovas, „Der Wachturm“, erschien. Und, und, und ...
Das frischgebackene Ehepaar Adolf und Emma Gerst übersiedelte nach Cottbus in die Niederlausitz und eröffnete einen Kolonialwarenladen. Aber der neue Broterwerb, den sie sich da seltsamerweise gewählt hatten, florierte nicht. Der mündlichen Überlieferung nach trieb Adolf seine Frau und alle Kunden zur Verzweiflung. Dieses Geschäft lag im nicht im Blut; er war einfach zu pingelig, der reinste Umstandskrämer. Wog er zum Beispiel Zucker ab, nahm er eine Prise rauf auf die Waage, dann eine Prise wieder runter von der Waage, und so ging das mehrmals hintereinander. Er fand einfach nicht das richtige Maß. Bald war die Kundschaft es leid und kaufte woanders ein. Das Geschäft endete in einer totalen Pleite. Adolf schmiß alles hin und ging vernünftigerweise in den Tuchmacherberuf zurück. Er zog mit seiner Familie in die Nachbarstadt Forst in die Berliner Straße 50, wurde dort Direktor einer Tuchfabrik und lebte nun in bescheidenem, aber immerhin gesichertem Wohlstand.
Forst war eine aufstrebende Stadt mit über 145 Tuchfabriken und wurde „Manchester des Ostens“ genannt. Man verdiente gut dort. Jeder fand Brot und Arbeit. Nach Eröffnung der Eisenbahnlinie Cottbus - Forst - Sagan lag die Stadt noch günstiger im Geschäft und wuchs und wuchs. Keine andere Stadt hatte auch so eine Sensation aufzuweisen wie Forst: eine ganz neuartige Stadtbahn, die bald liebevoll die „Schwarze Jule“ genannt wurde. Auf Schmalspurschienen ratterte, schnaufte und dampfte die mit Kohle angetriebene Bahn durch die Stadt. Vom Bahnhof aus fuhr sie durch die Forster Hauptstraßen und versorgte die großen Tuchfabriken und die Gasanstalt mit Brennmaterial und überhaupt mit allem, was benötigt wurde. Ihr Schienennetz war 25 km lang, und genau einhundert Jahre diente sie treu und zuverlässig, bis man sie nicht mehr brauchte. Von 1893 bis 1993 gehörte die Schwarze Jule zum Stadtbild, und es fällt schwer zu wissen, daß es sie nicht mehr gibt. Hoffentlich ist sie wenigstens in einem Museum gelandet und nicht verschrottet worden, denn für alle echten Forster war die Schwarze Jule nicht nur eine kleine schwarze Lokomotive, die schnaufte und pfiff, sondern ein beseeltes Wesen.
Schon 1892 konnte Forst ein Amtsgericht, ein Krankenhaus, ein Gymnasium, eine Schule für höhere Töchter und eine Webschule aufweisen. Es tat sich was in dieser Stadt. Nicht, daß Forst eine besonders schöne und malerische Stadt war - dafür gab es zu viele Fabriken. Aber die Fabriken hatten natürlich Besitzer, und die wollten gerne zeigen, was für reiche Leute sie doch waren. Sie ließen sich - oft von berühmten Baumeistern - wunderschöne Villen bauen, und diese prägten Forst, und so entstand eine eigenartig gemischte Stadtansicht.
Altersversorgung im heutigen Sinne gab es noch nicht. Aber Adolf dachte an die Zukunft. Er erwarb ein kleines, aber sehr hübsches Mietshaus in bester Forster Wohnlage in der Sorauer Straße 5. Das war nicht weit vom Bahnhof entfernt, an der Bahnschranke, gleich neben der Ecke mit dem Café Viktoria. Es war ein gutes und solides Haus, ein Haus für bessere Leute - wie man früher so sagte. Eine Baufirma Mattig & Lindner hatte es 1906 ursprünglich für sich selbst gebaut, es dann jedoch im gleichen Jahr an Emma und Adolf verkauft.
Als Emma das Haus als junge Frau bezog, war es außen und innen mit Stuck verziert, und auf dem Dach thronte ein kleines Türmchen. Es hatte drei geräumige, herrschaftliche Wohnungen mit drei Wohnzimmern, einem sehr großen Schlafzimmer, Bad und begehbarer Speisekammer. Die Zimmer gingen von einem langen Korridor ab, waren mit Parkettfußböden ausgestattet und hatten doppelte Flügeltüren, die die drei nebeneinander liegenden Wohnzimmer auch miteinander verbanden. Jeweils vorne und hinten heraus lagen kleine Balkone. Im obersten Geschoß lagen noch eine Zweizimmerwohnung, der Trockenboden und fünf Kammern für die Dienstmädchen. Eine Waschküche für alle befand sich im Keller.
Das Haus war liebevoll im kleinstädtischen Stil ausgestattet, mit Windfang im Hausflur, gedrechseltem Treppengeländer und sogar mit Gardinen an den Fenstern des Treppenhauses. Sehr schön wirkten die großen, gläsernen, dreiflügligen Korridortüren. Emma und Adolf bezogen die Parterrewohnung, zu der die schönste Tür gehörte. Sie war im Jugendstilmuster bunt bemalt und enthielt auch das Zunftzeichen von Mattig & Lindner, einen Hammer und einen Zirkel. Wenn die Sonne auf dem Haus lag, leuchtete sie prächtig in Rot und Gelb und erhellte den sonst etwas finsteren langen Korridor wie ein orangenfarbener Edelstein. Emma kratzte sich sogleich an einer unauffälligen Stelle ein winziges Guckloch, um besser beobachten zu können, was sich im Hausflur so abspielte.
An der Rückseite des Hauses führte eine kleine Treppe vom Schlafzimmer aus ein paar Stufen hinunter in eine Veranda mit rankendem Wein, der das ganze Glasdach schattenspendend überwucherte, und in einen winzigen Garten. Adolf und Emma pflanzten einen Apfel- und einen Birnbaum und auch einen Pfirsichbaum, der später so große, saftige gelbe Früchte trug, wie sie jetzt in Deutschland gar nicht mehr wachsen. Der Garten grenzte fast an die Schienen der Bahn nach Weißwasser-Sorau. Aber es fuhren noch nicht viele Züge, und man gewöhnte sich bald an das Gepolter der rangierenden Züge und an das Vorbeirauschen der Eisenbahn, man wußte genau, wann sie fällig war, wartete schon auf sie und plante sie mit in das Leben ein. Die Bahnanlage brachte den Vorteil, daß es für das Haus kein Gegenüber gab. Jenseits der Gleise entstanden Sport- und Grünanlagen mit einem Wasserturm als Krönung.
Heute, nach vierzig Jahren DDR, ist das Haus armselig und heruntergekommen. Der Glanz ist erloschen, lebt nur noch in der Erinnerung.
Die Forster gaben ihr gut verdientes Geld auch gerne wieder aus. Es entstanden viele große und lockende Ausflugslokale rund um das Städtchen, in denen nachmittags die beliebten Hefeplinsen gebacken wurden. Es lebte sich angenehm, und man verstand zu leben im alten Forst.
Emma „schenkte“ ihrem Adolf im Laufe der Zeit zehn Kinder; darunter ein Zwillingspärchen. Noch immer war die Säuglingssterblichkeit hoch. Vier Kinder gingen schon als Babys wieder von dieser schönen Welt; am Leben blieben Willi als Ältester, dann Bruno, Otto, Emma, Meta und Walter als jüngstes Kind. Walter, das Nesthäkchen, erhielt stets die größte Liebe von Emma; an ihm hing sie mit besonderer Aufmerksamkeit und Fürsorge.
Berta Meta Charlotte, geboren am 17. März 1895, wurde später meine Mutter. Zeitlebens ärgerte sie sich über ihren Namen. Sie hat ihren Eltern nie verziehen, daß ihr Rufname ausgerechnet Meta sein mußte. Bis ins hohe Alter war ihr dieser Name ein Gräuel. Ich vermutete, daß hinter dieser Abneigung etwas besonderes steckte, und als ich selbst schon viele Jahre verheiratet war, fragte ich sie einfach mal nach dem Grund dieses Widerwillens. Sie druckste zuerst lange herum, aber schließlich gestand sie doch, daß ein frecher Forster Junge ihr auf dem Schulweg immer leise zugerufen hat: „Meta, mir steta!“. Da verstand ich.
Aber der Reihe nach: Sie war ja nicht gleich meine Mutter, sondern erst einmal nur die kleine Meta Gerst, die 1895 auf die Welt gekommen war.
In diesem Jahr entdeckte W. C. Röntgen die elektromagnetischen Strahlen. Lenin gründete einen Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse. Im Berliner Varieté Wintergarten wurden die ersten „Lebenden Bilder“ vorgeführt, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde fertig gestellt und der Alexanderplatz erhielt eine kupferne Berolina. Ein Film dauerte etwa eine Minute. Die Welt traf Vorbereitungen für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Friedrich Engels, der Mitbegründer des Kommunismus, starb im Alter von 74 Jahren. In Braunau am Inn in Österreich wuchs ein kleiner Junge heran, damals 6 Jahre alt, der später die Welt verändern und Millionen Menschen ins Verderben führen wird - Adolf Hitler.
Die kleine Meta wurde von Eltern und Geschwistern nur Kleine oder Maus genannt. Leider fand sie im Elternhaus nicht die Zärtlichkeit, nach der sie sich sehnte. Emma und Adolf erzogen ihre Kinder mit Strenge; antiautoritäre Erziehung war noch nicht „in“. Kinder hatten zu parieren, und das sofort und ohne lange Widerrede. Das war üblich und wurde überall so praktiziert - meistens jedenfalls. Meta kann sich später an keine zärtliche Geste ihrer Eltern erinnern. Es fehlte nicht an Pflege, nicht an Aufsicht, und die Kinder bekamen alles, was nötig war; es war eben ein gutbürgerlicher Haushalt. Aber Gefühlsduselei und Verzärtelung gab es nicht. Die Kinder sollten zu rechtschaffenen Menschen erzogen werden - streng, aber gerecht, und niemand hatte dabei ein schlechtes Gewissen. Die Kinderseelen froren oft. Gefühle mußte jeder mit sich selbst abmachen, darüber wurde nicht geredet: Es wurde über Tatsachen gesprochen, wohl auch über Pläne, aber nie über Träume. Man tat, was sich schickte, was ordentlich und anständig war. So erzog man die kleine Meta, und so hielt sie es später auch mit ihren eigenen Kindern.
So recht schienen diese Erziehungsmethoden jedoch nicht zu fruchten, jedenfalls konnte man bei Meta von Zweifeln befallen werden. Sie heckte die gleichen Streiche aus wie alle anderen Kinder auf dieser Welt. Oft trieb sie ihr böses Spiel mit einem alten, borstigen Mann, der über alles und jedes meckerte. Zu seiner Wohnung gehörte ein zu ebener Erde gelegenes Fenster zur Straße hinaus. Es war in einen kleinen Vorbau des Hauses eingebaut, rechts und links davon führte eine Treppe nach oben zur Haustür. Die Tür zu seiner eigenen Wohnung lag auf dem Hof, also ein sicheres Stück entfernt.
Wußte Klein-Meta nun, daß er zu Hause war, pflegte sie unten an das Fenster zu klopfen und die Treppe hinaufzuflitzen. Steckte der Alte dann den Kopf aus dem Fenster, um zu sehen, wer da etwas von ihm will, spuckte sie ihm von oben kräftig drauf. Kam er fluchend angelaufen, war Meta schon längst auf der Flucht. Der Alte kam nie dahinter, wie das ungezogene kleine Mädchen hieß, denn natürlich spielte sich das nicht in der Nähe des Elternhauses, sondern in einer anderen Straße in sicherer Entfernung ab. Ansonsten spielte Meta die Kinderspiele, die alle anderen auch spielten: Verstecken, Einkriegezeck oder Fangen, sehr gerne Hopse, Trieseln mit der kleinen Peitsche oder auch mit dem Reifen. Vieles davon ist heute vergessen. Ihr beliebtester Abzählreim hieß: Äbchen, Bäbchen, Israelchen, Äbchen, Bäbchen Knoll.
Metas auserkorene, herzallerliebste Busenfreundin war Lieschen, die Tochter vom reichen Fleischer Richard Menzel aus der Bahnhofstraße. Lieschen wurde der Lichtpunkt in Metas Kindheit. Die Mädchen besuchten die höhere Töchterschule, und was Meta an Dummheiten nicht einfiel, das fiel ganz bestimmt Lieschen ein. Diese kleine Person ließ sich auch durch die Strenge in Metas Elternhaus nicht abschrecken, fürchtete sich vor nichts und lachte und kicherte über alles. Lieschen war schon von der Gestalt her viel robuster als die zierliche, kleine Meta. Sogar Emma und Adolf mochten Lieschen gern und duldeten sie als einzige Freundin im Haus.
So durfte Meta Lieschen öfter zum Kaffee einladen, und Lieschen kam gerne. Meta dagegen ging bei Menzels ein und aus wie es ihr beliebte. Da herrschten ganz andere Sitten, und sie war den gutmütigen Leuten immer willkommen. Durch das florierende Geschäft, die eigene Schlachterei, die vielen Kinder und das notwendige Dienstpersonal ging alles etwas drunter und drüber. Wie oft fischte Lieschen ihrer Freundin im Laden ein Keilchen heiße Knoblauchwurst aus dem Kessel? Unzählige Male. Dem rundlichen Lieschen hingen Wurst und Speck fast zum Halse heraus, darum tauschten die Mädchen in der Schule ihre Pausenbrote. Meta hatte immer nur Butterstullen mit, und die konnte sie wiederum schon kaum mehr sehen. Lieschen war ihre kulinarische Rettung, und so manche dick belegte Semmel landete in Metas Mündchen.
Trotz der gewissen Wohlhabenheit, herrschte in Emmas und Adolfs Haushalt größte Sparsamkeit. Man sparte für spätere Zeiten, wollte im Alter Rücklagen besitzen. Sparsamkeit fiel Emma nicht schwer, die kannte sie aus ihrem eigenen Elternhaus. Am Essen konnte man sehr gut sparen. Mit Grausen hörte ich von sonnabendlicher Buttermilchsuppe zu Bratkartoffeln. Das Essen war also einfach, aber kräftig. Wurst aß eigentlich nur der Vater. So war das damals Sitte. Wie gut, daß es für Meta Lieschen gab. Obst in Hülle und Fülle und so viel jeder mochte - das gab es nicht. Selten wurden im Winter Orangen gekauft - eigentlich nur zu Weihnachten. Man hielt sich an die im Keller eingelagerten Äpfel und Birnen.
Emma ging regelmäßig auf den Markt - mit Hut und Handschuhen selbstverständlich. Dort hockten die Bauersfrauen im Kreise ihrer Tragekörbe und Kiepen, und die Waren durften gekostet und befühlt werden. Aus dem Kosten der Butter machte Emma regelmäßig eine Wissenschaft. Kam sie vom Markt nach Hause und hatte zum Beispiel süße Kirschen mitgebracht, durften die Kinder nicht etwa darüber herfallen und nach Herzenslust schmausen - nein, jedes bekam eine Handvoll, und damit hatte es sich. Vielleicht gab es am nächsten Tag wieder eine Handvoll. Man hatte nicht gierig zu sein, mußte sich beherrschen und bescheiden. Gewiß, sie war sparsam, aber alles mußte von frischer, allerbester Qualität sein. Bestimmte Bauern kamen Jahr für Jahr direkt ins Haus und lieferten - je nach Jahreszeit - Spargel, Erdbeeren, Karotten, Pilze, Eier und die von Emma so geliebten Zuckerschoten voll lieblicher Süße.
Für den Winter wurde eingelegt und eingekocht. Dicke braune Steintöpfe wurden mit Senfgurken gefüllt, die nach Dill und Meerrettich dufteten, unvergeßlich auch der Kürbis in dickem Zuckersirup mit Ingwer, Zitronen und schwarzen Vanilleschoten. Essiggurken und eingedickte Preiselbeeren warteten auf die Sonntage, und ganz klein geschnittene grüne Bohnen, gesalzen, in Flaschen gestopft, mit klarem Wasser aufgefüllt und verkorkt, standen für winterliche Eintöpfe in den Regalen der Speisekammer. Sogar hundert Eier schwammen in Salzlake und warteten darauf, verzehrt zu werden. Ein wundersames Gemisch vieler Aromen füllte die Kammer mit einem unvergeßlichen Duft, den man heute nicht mehr kennt. Im Keller buddelte man Rüben in Sand und kellerte zentnerweise Kartoffeln ein - aber nur Nieren durften es sein. Auf Hürden lagerten Äpfel und Birnen. Emma legte einen verbissenen Ehrgeiz an den Tag, alles einzubunkern und zu beweisen, daß sie eine gute Hausfrau war.
Wochentags aß man in der Küche an dem großen Tisch, der in der Mitte stand. So hatte es Emma bequemer, denn ein Dienstmädchen leisteten sich die Gerst’s nicht. Kam Besuch, borgte man sich von befreundeten Familien oder Mietern aus dem Haus, die fast alle eines hatten, für ein paar Stunden eines aus. Die Kinder durften bei Tisch nur sprechen, wenn Erwachsene sie etwas fragten. Sie durften nie selbst von den Speiseplatten nehmen - nur wenn ihnen ausdrücklich angeboten wurde, und dann nur von oben - nicht etwa von unten hervorzotteln. Niemals das beste Stück; immer das geringste. Wer Gier zeigte, galt als unverschämt. Wehe dem, der kleckerte oder schmatzte; das waren fast Todsünden. Wehe dem, der manschte, seine Suppe schlürfte oder den Teller drehte, mit dem Stuhl kippelte oder mit seinen Beinen anderen unter dem Tisch ins Gehege kam. Kerzengerade mußte man sitzen; die linke Hand - wenn man nicht mit Messer und Gabel aß - leicht auf der Tischkante, die Ellenbogen möglichst eng am Körper und nicht etwa auf dem Tisch. Unholde, die sich nicht zu benehmen wußten, wurden in der Tischgemeinschaft nicht geduldet; sie wurden verbannt - strafversetzt an ein Kindertischchen. Meta und Lieschen landeten wegen respektlosen Benehmens im Beisein Erwachsener, albernem Getue und Gekicher oft auf diesem Strafplatz. Zu Metas Entzücken sagte Lieschen einmal, sie säße sowieso viel lieber in der Nähe des Fensters, weil da immer so schöne Blumen stehen. Emma zog dort Azaleen, Amaryllis und Clivien.
In die Kirche ging man selten. Es wurde zwar vor allen Mahlzeiten gebetet und danach ein Wort des Dankes gesprochen, auch ein Nachtgebet war selbstverständlich, aber im Tagesablauf spielt die Religion keine Rolle. Die Kinder wurden in der Forster Stadtkirche getauft und konfirmiert, mal besuchten Adolf und die Kinder ordentlich herausgeputzt sonntags auch einen Gottesdienst, aber wohl mehr um zu sehen und gesehen zu werden. Adolf fühlte sich der Religion noch eher zugeneigt als Emma, die ja das Sonntagsessen richten mußte, wenn Adolf zum Gottesdienst ging.
Bei all diesen Schilderungen von Strenge und Sparsamkeit könnte fast der Eindruck entstehen, Metas Kindheit in ihrem Elternhaus wäre trostlos gewesen. Aber so war es ganz und gar nicht. Es gab viele schöne Stunden und Erlebnisse. Emma und Adolf waren gesellige Menschen, und an Abwechslungen mangelte es keineswegs. Sie waren sehr naturverbunden, und sonntags, wenn die Sonne schien, trafen sie sich mit befreundeten Familien und deren Kindern - eine dieser Familien hieß Klaunig -, und dann ging es hinaus in Gottes freie Natur. Kurz bevor es auf die Landpartie ging, nahm Adolf die Parade ab. Er legte außerordentlichen Wert auf gute, elegante und gepflegte Garderobe. Jeder mußte zur Kontrolle an ihm vorbeimarschieren. War er zufrieden, zog man fröhlich los, spazierte singend durch die Wiesen und Wälder der Forster Umgebung - vorneweg die Jungen mit ihren Botanisiertrommeln und den Schmetterlingsnetzen.
Es ging nach Noßdorf oder zum Lerchenfelsen, nach Enlo oder ins Waldschlößchen nach Scheuno, mal auch auf die nahegelegene Wehrinsel oder ins Schützenhaus. Wirtshäuser luden zur Einkehr ein, und es wurden große, bauchige Kaffeekannen auf die Tische unter schattigen Bäumen gestellt und Hefeplinsen - die Spezialität der Lausitz - gegessen. In den Wirtshausküchen rieb man die schwarzen Platten der riesigen Kohleherde, die meist frei mitten im Raum standen, mit Speckschwarte ein, füllte aus einem mächtigen Topf mit einer Kelle den Hefeteig auf, strich ihn glatt und rund und buk einen Plins respektablen Umfangs. War er duftend goldbraun, wurde er aus einem Napf mit flüssiger, aber nicht gebräunter Butter gründlich eingepinselt, anschließend mit feinem weißen Zucker bestreut und zusammengerollt auf einen Teller gelegt. Auf riesigen Tabletts schleppten die Bedienungen die Köstlichkeiten zu den hungrigen Gästen in den Garten.
In der Zwischenzeit hatten sich Butter und Zucker zu einer Art Honig verbunden. Hmm... Hier war alle Sparsamkeit vergessen, jeder durfte essen soviel er schaffte. Und nach dem Kaffee vertrieb sich die ganze Gesellschaft auf den Wiesen aufs angenehmste die Zeit: bei Spielen und mit der Jagd nach bunten Schmetterlingen, denen alle wie wild hinterher rannten, um sie zu fangen und zu Hause zu präparieren. Meta gruselte sich fürchterlich, wenn sie ihren Brüdern dabei zusah. - Wieder in Forst, wurde regelmäßig noch einmal ein Lokal aufgesucht - meist das Café Hartmut. Dort wurde zu Abend gegessen, und jedes Kind durfte selbst nach eigenem Wunsch bestellen. Metas Gelüste gingen dabei seltsame Wege. Sie bestellte sich immer nur heiße Schokolade und dünne Schnitten mit Bratenschmalz.
Einmal, Meta ging noch nicht in die Schule, passierte während eines Ausflugs ein schlimmer Unfall. Die Familie war ausnahmsweise nicht zu Fuß unterwegs, sondern hatte sich eine offene Pferdekutsche gemietet. Plötzlich erschraken die Pferde über irgendetwas und gingen durch. In rasendem Galopp jagten sie die Straße entlang, bis die Kutsche mit den laut schreienden Insassen umstürzte. Der kleinen Meta wurde der eine Unterarm in voller Länge tief aufgerissen, und sie verblutete fast. Es dauerte eine lange Zeit, bis die Wunde verheilte. Zeitlebens behielt sie zur Erinnerung eine lange Narbe. Seit diesem Erlebnis begegnete sie Pferden nur noch ungern und mißtrauisch.
Milch alleine - ohne Kakao - haßte Meta. Als sie das 8. Lebensjahr erreicht hatte, war sie so blaß und mickrig, daß die Eltern den Arzt kommen ließen. Er verordnete eine Kur mit frisch gemolkener, naturwarmer Milch. Meta gruselte sich fürchterlich. Jeden Tag mußte sie nun zu einem der umliegenden Bauernhöfe pilgern, um dort im Stall ihre Milch zu trinken, und jeden Tag packte sie der Ekel, und sie schüttelte sich vor Entsetzen. Eine Weile blieb sie artig und folgsam. Aber dann fing sie an, nur um den Bauernhof herumzuschleichen und nicht hineinzugehen und zu trinken. Dem Bauern war das egal; Hauptsache, die Kasse stimmte. Er hat also kassiert, sie aber nie verraten. Vielleicht mochte er selbst auch keine körperwarme Milch und hatte Mitleid.
1901 begann für die kleine Meta der so genannte Ernst des Lebens. Sie wurde eingeschult. Zuerst besuchte sie die Gemeindeschule in der Bahnhofstraße und wechselte dann über in die Schule für höhere Töchter. Von sich selbst behauptete sie, nie eine besonders gute Schülerin gewesen zu sein. Aber da sie ein Liebling ihrer Lehrer war, bekam sie zur eigenen Überraschung immer gute Zeugnisse. Ihr Poesiealbum von 1905 bis 1906 ist wunderbarerweise erhalten geblieben. Gefühlvolle Verse, die heute komisch anmuten, damals jedoch aus tiefstem Herzen geschrieben wurden, stehen darin. So etwa:
Ich saß in der Laube und schlief,
da kam ein Engel und rief:
Liesbeth, Liesbeth, du sollst aufstehn
und zu deiner Freundin gehn!
oder
Demut, Sanftheit, Fleiß und Frohsinn
sind des Mädchens Feierkleid.
Doch sein Kranz ist Herzensgüte
und sein Kleinod Frömmigkeit.
oder
So fest wie eine Eiche steht
in Sturm und Ungewitter,
so fest soll unsere Freundschaft blühn
bis an des Grabes Gitter.
Weil ich gerade bei Versen bin, will ich gleich noch ihren späteren Konfirmationsspruch aufschreiben. Er lautete: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Doch so weit sind wir noch nicht; bleiben wir noch etwas bei Metas Einschulungsjahr 1901. In Berlin wurden die ersten drei Kinderkrippen eröffnet - Tagespreis je Kind 20 Pfennig, und hier erschien auch die Erstausgabe von Thomas Mann’s „Buddenbrooks“. In England starb Königin Viktoria, in Mailand Giuseppe Verdi und in Frankreich Henri de Toulouse-Lautrec. Die Jugendbewegung „Wandervogel“ bildete sich in Berlin. Frankreich ließ eine Frau als Rechtsanwältin zu. In Südafrika gründeten Engländer Konzentrationslager; 20.000 Menschen kamen darin ums Leben. In Schweden verlieh der König die ersten Nobelpreise.
Zurück zu Meta. Die Kinder damals wurden gekleidet wie Erwachsene. Meta trug selbstverständlich lange Röcke, und alles war reizend mit Knöpfchen, Biesen und Borten verziert. Natürlich gehörte auch ein Hut dazu, denn der erst vervollständigte die Garderobe. Kam Meta aus der Schule, streifte sie die Schulkleidung ab und zog ein etwas einfacheres Hauskleid an. Darüber kam eine mit Spitzen und Stickereien geschmückte Schürze, die aussah wie ein loses Hängerkleidchen ohne Ärmel. Es gab natürlich auch noch Sonn- und Festtagskleider, die die Schneiderinnen besonders herausputzten. Metas dunkle, lockige Haare hielt Emma mit einem Band aus der hohen Stirn, damit das Töchterchen ja nicht etwa wild und zerzaust aussah; man hatte einen gesitteten und ordentlichen Eindruck zu machen. Meta blieb immer zierlich und zart von Gestalt und wie Emma mit hübschen feinen Gesichtszügen.
Adolf überragte seine Frau ein ganzes Stück, hatte schwarze Augen und schwarzes Haar, das sich verhältnismäßig schnell silbern färbte. Sein Gesicht schmückte ein gut gepflegter, gestutzter Bart. Ein Bart machte aus einem Mann erst einen richtigen Mann. Er schwärmte für ausgesuchte und korrekte Garderobe, zu der Röhrenhosen und Vatermörder gehörten. Es kann ruhig gesagt werden: Adolf und Emma bildeten ein gut aussehendes Paar mit hübschen Kindern.
Emmas Mann brachte dem Kaiserhaus treue Liebe und Verehrung entgegen, die er im wahrsten Sinne des Wortes teuer bezahlte: im Wohnzimmer und im langen Korridor hingen Bilder der kaiserlichen Familie und von der schon 1810 verstorbenen Königin Luise. Des Kaisers Geburtstag war ein hoher Feiertag - nicht nur für Adolf und die Seinen, sondern für fast alle Leute in der Stadt. Ganz Forst war dann auf den Beinen. Die Kinder bekamen schulfrei. Wenn die Sonne so richtig strahlte, sprach man von Kaiserwetter, putzte sich heraus und amüsierte sich. Alle Vereine veranstalteten Umzüge, und die Jugend lief fähnchenschwingend nebenher oder stand winkend und jubelnd am Bürgersteig.
Adolfs Gesangverein „Die Liedertafel“ sang öffentlich die alten deutschen Lieder von Vaterland und Treue und immer auch „Heil dir im Siegerkranz. Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir“. Adolf sang sehr gerne und sehr viel - auch zu Hause. Seine Lieblingslieder waren „Ännchen von Tharau“, „Gold und Silber lieb ich sehr“, „Vogelein im hohen Baum“ und „An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Mauern sind zerfallen. Wolken ziehn darüber hin ...“, aber auch „Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde“, „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ und „Goldene Abendsonne, wie bist du so schön, nie kann ohne Wonne deinen Glanz ich sehn ..“.
Sehr feierlich beging man auch den Sedantag. Abends fanden für alle Kinder lange Fackelzüge statt, und sie sangen mit glänzenden Augen: „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ oder „Hurra, Hurra, Hurallalallala“.
Das größte Fest aber war unbestritten das Forster Schützenfest. Oh - da war was los; da feierte man drei Tage. Metzgermeister Menzel, Lieschens Vater, wurde etliche Jahre hintereinander Schützenkönig, und das hat immer eine Menge Geld gekostet. Ein armer Mann konnte es sich nicht leisten, Schützenkönig zu sein, und aus diesem Grunde nahm man nur wohlhabende Männer in der Königsgilde auf. Früh beizeiten holten die Mannschaften den König mit lauter Musik von seiner Wohnung ab und begleiteten ihn aufs Schützenfest und zum Restaurant Schützenhaus. Da ging es hoch her - drei Tage, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Vor dem Schützenhaus standen noch zusätzlich große, bunte Zelte für die verschiedenen, zum Verein gehörenden Mannschaften. Da gab es zum Beispiel eine Jäger- und eine Grenadierkompanie und auch die Königskompanie, der die reicheren Mitglieder angehörten. Das Schützenfest war jedes Jahr ein Riesenspektakel. Es drehten sich Karussells, Blaskapellen spielten zum Tanz, und Würfelbuden und „Haut den Lukas“ sorgten für viel Spaß.
Fast alle großen Veranstaltungen und Aufführungen fanden im Schützenhaus statt. Ein Theater gab es in Forst leider nicht, deshalb fuhren Ema und Adolf oft mit der Eisenbahn nach Cottbus ins Konzert. Ein kleines Kino wurde eröffnet, aber das galt als ruchlos und gefährlich sittenverderbend. In so ein Etablissement setzten anständige Leute keinen Fuß.
In ihrem achten Lebensjahr erkrankte Meta auf Leben und Tod. Nicht nur sie alleine, sondern fast alle Kinder aus der Sorauer Straße wurden krank. Auf dem Weg zur Schule hatten sie unter Gespritze und Gejohle von einer Wasserpumpe getrunken. Das Wasser der Pumpe war verseucht, und Typhus brach aus. Die kleine Meta verlor vorübergehend alle Haare. Der Doktor verordnete Wechselbäder, also tauchte man die fast bewußtlose kleine Gestalt zuerst in einen Waschzuber voll eisigkaltem und dann in einen anderen mit tückisch heißem Wasser.
Meta schrie wie am Spieß, aber sie überlebte es. Fieber bekämpfte Emma sonst grundsätzlich nur mit Schwitzpackungen. Dazu mußte sich Meta nackend mit angelegten Armen hinstellen, Emma schlang ein großes, nasses, kaltes Laken um sie, darüber eine Wolldecke, und legte sie, verpackt und eingerollt wie eine Wurst, unter ein dickes Federbett. Zugedeckt bis zur Nasenspitze mußte Meta jetzt schwitzen, und es dauerte nicht lange, dann rann ihr das Wasser aus allen Poren. Eine riesige Portion Angstschweiß war immer dabei. Meta glaubte jedes Mal, ihre letzte Stunde hätte geschlagen. Sie konnte kaum einen Finger rühren und bekam regelrechte Todesahnungen, aber auch das überstand sie.
Forst war modern. Es gab sogar ein großes Schwimmbad mit Wasser aus einem künstlichen Abzweig der Neiße. Natürlich ging es dort streng sittlich zu: Männlein und Weiblein exakt getrennt. Keiner durfte ein nacktes fremdes Knie sehen, denn er hätte ja für alle Zeiten verdorben werden können. Man ging lang bekleidet ins Wasser und zog sich nur in bewachten Kabinen um. Daß Meta nie schwimmen lernte, war Lieschens Schuld. Beide waren in ihren schicken Badeanzügen, zugeknöpft bis obenhin, im Bad. Lieschen, die fixere, die längst schwimmen konnte, predigte immer auf Meta ein, sie solle ganz beruhigt vom Turm springen, denn sie, Lieschen, würde sie auffangen. In aller Unschuld und voll Gottvertrauen sprang Meta - und ging unter wie eine bleierne Ente; bis auf den Grund. Der Bademeister fischte sie besinnungslos heraus, stellte sie auf den Kopf und ließ sie auslaufen. Damit hatte es sich. Aber Meta betrat nie wieder ein Schwimmbad; bis ins Alter wurde ihr schon schwindlig, wenn sie nur in ein volles Waschfaß kuckte.
Metas Bruder Bruno bekam eines Tages von Emma den Auftrag, für einen schmackhaften Eintopf 10 Keilchen Schneidewurst vom Fleischer zu holen. Das tat der liebe Bruno auch, aber auf dem Heimweg fing er an, den Arm mit dem Einkaufsnetz wie ein Wilder durch die Luft zu schleudern, immer im Kreis und so weit er mit dem gestreckten Arm schleudern konnte. Als er zu Hause auspacken wollte, war die Wurst verschwunden.
Über Mittag kam Adolf wochentags zu Tisch nach Hause, und dann aß die Familie - wie schon einmal geschrieben stand - gemeinsam in der Küche an dem großen Tisch - nur sonntags wurde im Esszimmer gegessen. Als wieder einmal alle beim Essen saßen, kam einer von Adolfs Freunden aufgeregt hereingestürzt und rief: „Adolf, komm schnell mal mit! Das mußt du sehen, sonst glaubst du es nicht! Auf dem Sportplatz tut sich vielleicht was! Da steht eine Turnlehrerin vor ihrer versammelten Klasse und turnt ihnen was vor - aber du glaubst es nicht: Sie hat nur eine kurze Hose und ein kleines Hemdchen an! Zieh dich an! Das mußt du sehen!“ Adolf sprang entrüstet auf, griff zu Jackett, Hut und Spazierstock und eilte mit seinem Freund zu dem Schauplatz der Schändlichkeit. Er wollte sich mit eigenen Augen ein Bild von dem Geschehen machen. Es ist überliefert, daß die beiden nicht die einzigen Herren waren, die den Sportplatz empört umkreisten.
Von handwerklichen Arbeiten verstand Adolf nicht die Bohne und hat dieses Talent auch keinem seiner Söhne in die Wiege gelegt. Sie waren eine komplett hilflose Familie, wenn ein Nagel in die Wand geschlagen werden mußte oder ein Wasserhahn tropfte. War eine Sicherung durchgeknallt, mußte ein Handwerker kommen. Wagte einer der Mieter mal, irgendwie herum zu klopfen, suchte Adolf ihn sofort auf, um zu kontrollieren, ob das Gehämmere nötig sei oder ob schon gar ein Riesenloch in der Wand war - er schloß eben von sich auf andere. Die einzige Arbeit, die er mit Hammer und Säge verrichtete, erstreckte sich auf das Zurechtstutzen des Weihnachtsbaums. Und das dauerte drei volle Tage. Ach ja, Weihnachten!
Wenn auch fast das Jahr über im Alltag am Haushalt geknausert wurde, zu den Festen war alles anders. Viele Wochen vorher wurden schon Weihnachtslieder gesungen, und die Kinder wußten dann: jetzt kommt die schönste Zeit des Jahres, und sie freuten sich. Manchmal war es noch so zeitig, daß Emma zu Adolf sagte: „Nun mach’s mal halblang!“. Genau zwei Wochen vor dem Fest fing sie an, die Christbrote zu backen; mit reichlich guter Butter, Hefe, süßen und bitteren Mandeln, Rosen und Zitronat. Das ganze Haus duftete, und Emma schlug über jedem Laib das Kreuz, ehe sie ihn in den Ofen schob. Golden zog sie sie wieder heraus, packte sie in eine große Wanne, über die sie ein feuchtes Leinentuch hängte, und schleppte sie in den Keller. Nun mußten die Christbrote in Ruhe Feuchtigkeit ziehen. Es waren so viele, daß sie bis Ostern reichten.
Regelmäßig ging dem Fest ein kleiner Streit voraus, der gehörte schon fast zum Ritual: der Streit um den Weihnachtsbaum. Und das war so: Adolf ging immer mit den Kindern in die Stadt, um das Angebot der Händler gründlich zu studieren. Der Weihnachtsbaumkauf war der wichtigste Einkauf des Jahres. Vater und Kinder suchten begeistert herum, bis sie endlich ihren Tannenbaum entdeckten. Mit sich und dem Baum zufrieden, schleppten sie ihn glücklich nach Hause. Und jedes Jahr, das Gott werden ließ, fing Emma an zu meckern, wenn sie ihn sah. Nie gefiel er ihr. Einmal erschien er ihr zu klein, einmal zu groß, einmal war er zu dünn, einmal zu breit. Jedes Jahr packte Adolf eine schreckliche Wut, und er schrie in hellem Zorn: „Ich gehe nie wieder einen Tannenbaum kaufen!“. Aber jedes folgende Jahr zog er doch mit den Kindern wieder los.
Die Bescherung fand ausschließlich in der so genannten guten Stube statt, die nur den Festen und den Sonntagen vorbehalten blieb. Im täglichen Leben wurde ein anderes Wohnzimmer benutzt. In der guten Stube stand ein riesiger Spiegel zwischen zwei hohen Fenstern, die von blütenweißen Spitzengardinen verhüllt wurden. Ein Dekorateur drehte immer oben und an den Seiten kunstvolle Rosetten. Rechts und links vom Spiegel standen zwei gleiche, große chinesische Vasen, und wie in allen guten Stuben der damaligen Zeit fehlte es auch nicht an Plüschmöbeln, Teppichen, Fransenlampen, schweren Bildern und vielem Krimskrams.
Am 22. Dezember schloß sich Adolf regelmäßig in diesem Raum ein, und nicht mal Emma hatte mehr Zutritt. Die Kinder horchten neugierig und glücklich, wenn es hinter der Tür geheimnisvoll zu Sägen und zu Klopfen begann. Emma lächelte amüsiert, und alle wußten: jetzt nimmt Papa den Weihnachtsbaum auseinander. Und so war es. Adolf ging fast wissenschaftlich vor. Überall dort, wo er dachte, es wären zu viele Zweige, nahm er welche heraus, kürzte sie, wenn nötig, und setzte sie kunstvoll da im Stamm wieder ein, wo seiner Meinung nach welche fehlten. Er sägte, bohrte und werkelte, bis er den ganzen Baum umgemodelt hatte - bis ein Bilderbuch-Christbaum vor ihm stand. Dann setzte er ihn in ein mit Sand gefülltes Gärtchen aus Holz, um das ein vergoldetes Zäunchen lief und versah den Baum mit vielen weißen Kerzen, die in langen, in den Stamm gedrehten Haltern steckten - immer Lücke auf Lücke zwischen die Zweige. Er hängte glänzende Silberkugeln mit den zartesten Verzierungen, vergoldete Nüsse, allerliebste Glöckchen und schillernd bunte Vögelchen an, schmückte ihn mit Ketten, Lametta und Engelshaar, mit bebilderten Lebkuchen und vielen anderen Zuckersachen. Auf der Spitze schwebte ein Engelchen aus rosa Wachs. - Jetzt endlich durfte Emma die Stube betreten und bewundern, was Adolf vollbracht hatte.
Den ausgezogenen Tisch deckte Emma mit Damast und baute die Geschenke auf. Uneingepackt. Jedes Familienmitglied hatte seinen ganz bestimmten Stammplatz und bekam zu den Gaben noch einen voll gepackten bunten Teller mit Äpfeln, Nüssen, Orangen und Leckereien. Ein Duft lag in der Luft und drang durch die Türritzen, der alle Kinderherzen erwartungsvoll höher schlagen ließ - ein Duft, den man nur Weihnachten schnuppern kann. War alles gerichtet und alle Geschenke bereit, kam Adolf zufrieden und geheimnisvoll lächelnd wieder zum Vorschein und schloß hinter sich die Tür zu. Kein Kind durfte vor dem Heiligen Abend einen Blick in die gute Stube werfen.
Inzwischen hatte der Bauer die bestellte Gans gebracht. Emma befühlte und begutachtete sie immer mißtrauisch und fragte, ob sie auch nicht etwa mit Fischmehl gefüttert wurde, und jedes Mal verneinte der Bauer entrüstet. Schließlich sagte Emma gedehnt: „Na ja“ und bezahlte. Abends briet sie für Adolf die köstliche Leber mit Zwiebeln in einem schwarzen eisernen Pfännchen, und wenn er gute Laune hatte, durften die drumrum stehenden Kinder davon naschen. Hatte er keine gute Laune, dann nicht. In der Badewanne schwamm derweilen der arme große Karpfen und wartete auf sein letztes Stündlein. In jedem Jahr entsetzte sich dann die kleine Meta, wenn sie glaubte, der Fisch hätte sie mit seinen Glubschaugen vorwurfsvoll angesehen. Für sie lag ein Zauber über diesen Tagen. Sie konnte es kaum erwarten. Endlich war es doch soweit: der Weihnachtstag brach an.
In der Dämmerstunde kleidete sich die gesamte Familie festlich an und ging gemeinsam zur Christnachtsfeier in die Forster Stadtkirche - ein ehrwürdiges altes Gotteshaus, dem Heiligen Nikolaus geweiht, dem Beschützer der Kinder und der Familien. Der Grundstein der Kirche ist vermutlich schon 1266 gelegt worden. Zu Weihnachten standen zwei riesige Tannenbäume mit brennenden Kerzen rechts und links des Altars, und ein weiterer, noch viel größerer, stand vor dem Kirchenportal. Wegen der brennenden Kerzen nahm auch in jedem Jahr eine Abordnung der Feuerwehr am Gottesdienst teil, was die Kinder wahnsinnig spannend und aufregend fanden.
Meta interessierte sich nie für die Predigt und hätte auch nie sagen können, was der Pfarrer da eigentlich erzählt hat. Sie war viel zu aufgeregt. Die uralte Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu gefiel ihr schon besser, und die Lieder sang sie auch alle mit, die konnte sie. Brausend und jubelnd erfüllte die Musik der neuen Orgel das Kirchenschiff: O du fröhliche, O du seelige gnadenbringende Weihnachtszeit. Stolz und ergriffen lauschte die Gemeinde. Der Rektor der Mittelschule, Herr Hermann Standke, schreibt 1922 in seinem Buch über Forst: „Der Kirche schönster, aber auch teuerster Schmuck ist die neue Orgel, erbaut von dem Orgelbauer Gustav Heinze in Sorau. Sie hat 62 klingende Stimmen mit 4.302 Pfeifen, deren größte 4,80 m und deren kleinste 6 mm mißt. Die Windbeschaffung, die in der Minute 42 cbm Wind liefern kann, geschieht auch auf elektrischem Wege. Sie kostete mehr als 200.000 Mk, die durch freiwillige Spenden aufgebracht wurden.“
Wieder zu Hause, klopfte Metas Herzchen vor Erwartung und Anspannung ganz hoch im Halse. Schließlich erklang dann das ersehnte Läuten des Glöckchens, das zur Bescherung rief. Die Tür zum Paradies öffnete sich.
Nach dem Betreten des Weihnachtszimmers schielten die Kinder erst mal kurz auf ihren Platz. Vor der Bescherung stellten sich dann aber alle vor dem Tannenbaum auf und sangen „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Anschließend mußten alle Kinder einzeln ihr Gedicht aufsagen, das sie auswendig gelernt hatten, und das taten sie auch gehorsam. Zwischendurch huschten ihre Blicke jedoch immer wieder über ihre Tischecke mit den Geschenken oder lagen bewundernd auf dem Glanz des Weihnachtsbaums. Danach durften sie endlich an den Gabentisch.
Die meisten Träume der Kinder erfüllten sich. In jedem Jahr gab es wundervolle und teure Geschenke. Meta erinnerte sich später besonders an ein Fest, an dem für sie eine große neue Puppe in einem Kinderstuhl neben dem Baum saß. Ein Bild von einer Puppe: der Körper und die Glieder aus feinstem hautfarbenen Leder, der Kopf und die Händchen aus zartem rosigem Porzellan. Die langen Haare hatte ein Frisörmeister aus Emmas ausgekämmten wundervollen Haaren handgeknüpft, Wäsche und Kleider waren von der Hausschneiderin genäht, Hut und Haube stammten von der Putzmacherin und die kleinen zierlichen Schuhe vom Schuhmachermeister in der Cottbusser Straße. Meta nahm die Puppe ganz ehrfurchtsvoll in die Arme. Es war zwar keine Puppe zum Knuddeln oder gar Herumschmeißen, aber sie ließ sich gern in Metas Puppenwagen mit den großen hohen Rädern spazieren fahren. Sie erregte überall große Bewunderung, hauptsächlich natürlich bei Metas kleinen Freundinnen. Meta liebte die Puppe heiß und innig.
In einem anderen Jahr schenkten ihr die Eltern einen Kaufmannsladen mit allem Zubehör. Meta schrie vor Wut, als ihre Geschwister ihr mit harmlosem Gesicht die leckersten Sachen im Spiel abkauften und sofort im Mund verschwinden ließen. Einmal bekam sie zu Weihnachten auch einen mit Spiritus beheizbaren kleinen Küchenherd, auf dem sie richtige Puppenmahlzeiten kochen konnte; im Backofen backte sie echte kleine Kuchen. Wieder umkreisten sie die Brüder wie Geier und warteten auf die süßen Speisen, die Meta bruzzelte. Hauptsächlich dann, wenn sie Walnüsse in Butter und Zucker schmurgelte, gingen sie ihr nicht von der Pelle. Zum Herd gehörte ein ganzes Sortiment an Töpfen, Pfannen, Kasserollen und Kesselchen, alles aus blitzendem Kupfer, und damit sie auch alles hübsch servieren konnte, gab es noch allerliebstes Porzellangeschirr mit bunten Streublümchen.
Natürlich besaßen Meta und ihre Schwestern ein großes Puppenhaus mit allem, was man sich vorstellen kann. Vom Kerzenleuchter bis zu Fußbänkchen und Nachttopf war alles vorhanden. Die Vorderfront trug reiche Verzierungen, Erkerchen und Blumenkästen an den Fenstern. Mit zwei großen Türen konnte die Rückseite verschlossen werden, damit die kunstvoll handgefertigten winzigen Möbel nicht einstaubten. Meta spielte viel damit. Das Puppenhaus war eine getreue Abbildung der Erwachsenenwelt im kleinen - so richtig für die Mädchen geschaffen, die ja auch einmal Hausfrau werden sollten.
Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es selbstverständlich die traditionelle Weihnachtsgans. Emma füllte sie liebevoll mit süßsauren Äpfeln und Beifuß, ehe sie in den Bratofen geschoben wurde. Bald hoben alle schnuppernd die Nasen. O - wie das duftete. Dazu gab es immer Grünkohl und Preiselbeeren. Nie ließ sich Adolf das Recht streitig machen, das Fleisch zu schneiden - und das hätte auch keiner gewagt. Das Schneiden des Fleisches war Sache des Hausherrn, eine Selbstverständlichkeit war das, eine verdiente Ehre. Er hatte das Fleisch für die Seinen erarbeitet - er teilte es ihnen zu.
Und in jedem Jahr zankten sich die die Kinder um die Klapper der Gans, ein bestimmtes Teil des Gerippes.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam der Karpfen von der Badewanne in polnischer Soße aus Braunbier mit Rosinen und Pfefferkuchen auf den Tisch. Um seinen Tod gab es regelmäßig beinahe ein Drama, weil die Kinder ihn in der Zwischenzeit lieb gewonnen hatten und fast ein Familienmitglied in ihm sahen. Adolf, sonst kein großer Tierfreund, Katzen haßte er sogar, konnte trotzdem keinem Tier ein einziges Haar krümmen, geschweige denn, einen großen Karpfen schlachten. Aber immer wieder zu Weihnachten verlangte Emma genau das von ihm, und er schrie: „Um Gottes Willen! Ich doch nicht!“ Dann wurde extra eine Frau geholt, die den Karpfen ermordete. Sie kam immer für alle schweren Arbeiten, die kein anderer machen wollte und erschien auch schon vor Weihnachten, um den Teig für die Christbrote zu kneten, denn das war für Emma zu anstrengend.
Aber schnell noch einmal zurück zu Adolfs Abneigung gegen Katzen. Die Familienmitglieder kannten sie natürlich, und so standen sie eines schönen Sommerabends recht ratlos um sein Bett herum. Emma hatte es kurz zuvor für die Nacht aufgeschlagen, und was entdeckte sie zu ihrem Entsetzen? Eine wildfremde Katze mit ihren neugeborenen Jungen! Sie konnte nur durch die offen stehende Schlafzimmertür, die in den kleinen Garten führte, hineingelangt sein. Adolf tobte und schrie: „Ausrechnet in mein Bett! Die Viecher müsste man ersäufen!“ Dagegen erhob sich ein großes Protestgeschrei, sogar Emma beteiligte sich daran, und daraufhin wagten es die Kinder, noch lauter um das Leben der Katzenfamilie zu bitten. Und sie hatten auch Erfolg. Nach einer schier endlosen Telefoniererei fand man im Bekanntenkreis endlich eine Familie, die das Katzenglück aufnehmen wollte. Emma besorgte eine kleine Kiste, polsterte sie mit Lumpen aus und setzte das ganze Idyll hinein. Die Kinder trugen sie mit etwas Wehmut im Herzen aus dem Haus, aber Adolf knurrte befriedigt: „Das hätte mir gerade noch gefehlt“.
Silvester feierten alle zusammen ruhig und besinnlich. Emma braute würzigen, aromatischen Rotweinpunsch und reichte dazu selbstgebackene Pfannkuchen mit Pflaumenmus gefüllt, oder in Streuzucker gewälzte Grabbelchen, auch Nonnefärzchen genannt. Gesellschaftsspiele wurden gespielt und lebende Bilder dargestellt, und wenn um Mitternacht die Glocken läuteten, erhob man sich, stieß an und wünschte sich gegenseitig ein frohes und gesundes neues Jahr.
Tags darauf, am Neujahrsmorgen, vormittags um 11.00 Uhr - niemals später, niemals früher -, machten Adolf und Meta einen wichtigen Spaziergang. Meistens lag Schnee. Die beiden gingen in die schöne alte Villa des Besitzers der Tuchfabrik, in der Adolf Direktor war, und brachten höflicherweise ihre guten Wünsche für das neue Jahr dar. Sie wurden schon erwartet und mit Wein, Limonade und kleinen Häppchen bewirtet. Nach einem Stündchen verabschiedeten sie sich wieder und gingen heim.
Beim gemeinsamen Neujahrsspaziergang fand die kleine Meta den Weg durch die Straßen von Forst am schönsten. Sie sah entzückend aus und zeigte sich gerne in dem langen, pelzbesetzten Mäntelchen, dem passenden Käppchen und dem Muff, in dem die Händchen steckten, und mit den Stiefelchen mit unendlich vielen Knöpfchen. Wie eine kleine Prinzessin sah sie aus. Adolf war stolz auf sein Töchterchen und nahm sie gerne mit. In der Stadt kannte ihn fast jeder, und dauernd rief man sich „Frohes neues Jahr!“ zu. Ununterbrochen mußte Adolf den Zylinder lüften, und Meta winkte mit den Händchen einen Gruß und knickste. Die Straßen waren erfüllt von Menschen, die Neujahrsbesuche machten oder mit Schlittschuhen über den Schultern der zugefrorenen Neiße zustrebten.
Schließlich waren die Feiertage vorbei, und der Alltag kehrte ein. Meta spielte weiter glücklich und zufrieden mit ihrem neuen Spielzeug - bis zu einem schrecklichen Tag Anfang Februar. Sie wußte, daß er bald kommen würde. Wenn sie an diesem Tag von der Schule heimkehrte, hatte Emma all die schönen Spielsachen weggeräumt. Unerbittlich und gnadenlos packte Emma die ganze Pracht in Kisten und verfrachtete sie auf den Boden. Immer traf es Meta unsagbar schmerzhaft, und immer geschah es, wenn sie in der Schule war.
Zu einem der nächsten Feste, wie zum Beispiel zu Ostern, zu einem Geburtstag, oder auch bei Krankheiten holte Emma zwar alles wieder hervor, doch zunächst blieb Meta tagelang unglücklich. Sie nähte aber weiter für ihre Puppen, wie eine Mutter, deren Kinder gerade verreist sind. Mit Nadeln, Garn und bunten Lappen konnte sie stundenlang vor sich hin puzzeln, und die Welt um sie herum versank. Unnützes Herumsitzen duldeten die Eltern sowieso nicht; das galt als Faulheit. Meta hatte noch ganz kleine ungeschickte Händchen, da mußte sie schon in die Handarbeitsstunde zu zwei alten Fräuleins gehen und komplizierte Stickereien erlernen. Die Fingerchen wollten noch gar nicht richtig.
Ein Taschengeld kannte sie nicht, also mußte Meta Geschenke für die Eltern selbst anfertigen: für die Mutter Deckchen, Schürzen, Beutel für Wäscheklammern, Brot oder Semmeln und Überhandtücher, auf denen stand „Ohne Fleiß keinen Preis“ oder „Eigener Herd ist Goldes wert“, für den Vater Bartbinden, Hauskäppchen oder besticke Oberteile für Hausschuhe, die der Schuster dann weiterverarbeitete. Sie häkelte auch meterweise Spitzenborten, die dann mit Reißnägeln an die Vorderkanten der Zwischenbretter von Schränken, hauptsächlich Wäsche- und Küchenschränken, gepinnt wurden und der Stolz jeder Hausfrau waren. Aus hauchdünnen Garnen gehäkelte Spitzen verzierten die langen Damenunterhosenbeine. Diese Hosen bestanden aus blütenweißem, feinen Leinen oder aus Batist - Batist war schon etwas sündhaft - und wurden in der Taille mit einem Seidenband zugebunden. Hinten blieben sie offen, gingen aber etwas übereinander. Marktfrauen oder sehr einfach gestellte Frauen trugen solche Hosen nicht - sie trugen gar keine. Meta fand es immer faszinierend, wenn sie auf der Straße beobachten konnte, wie manche Weiber sich einfach breitbeinig hinstellten und man es plötzlich plätschern hörte. Das machte immer mächtigen Eindruck auf sie.
Ostern wurden eine Menge Eier gefärbt. Emma kochte die rohen Eier in Zwiebelschalen bis sie hart waren, schreckte sie ab und rieb sie mit einer Speckschwarte glänzend; sie hatten dann eine schöne, appetitliche braune Farbe. Zusammen mit Süßigkeiten verstecken die Eltern die Ostereier in Nestern, Körbchen und bunt beklebten großen Pappeiern in der ganzen Wohnung, bei schönem Wetter auch im kleinen Garten. Jubelnd suchten die Kinder, bis auch das letzte Ei gefunden war. Am Nachmittag spielten sie mit den Nachbarskindern bei Sonnenschein auf dem Hof, bei Regenwetter auf dem großen Hausboden unter dem Dach. Jedes Kind brachte ein Körbchen voll Eier mit, und dann wurde gewalleit. Walleien ist ein ähnliches Spiel wie Murmeln: mit Gewinn und Verlust.
Geburtstage nahm man nicht wichtig. Nie durfte Meta, wie andere Kinder, ihre Freundinnen einladen und wurde deshalb in der Schule oft bedrängt. „Warum lädst du uns nicht ein?“ Einmal schämte sie sich deswegen, und es fehlte ihr der Mut zu sagen, daß die Eltern das nicht erlaubten. Sie fühlte sich in die Enge getrieben, wußte sich nicht mehr zu helfen und sagte in ihrer Not einfach: „Ja, natürlich - ich lade euch alle ein.“. So kamen am 17. März pünktlich zum Kaffee acht kleine Mädchen mit Blumensträußchen und wollten Geburtstag feiern. Emma traf wohl fast der Schlag, aber sie behielt die Nerven, denn blamieren wollte sie sich nicht - die Haltung muß in jeder Lebenslage bewahrt bleiben. Sie schickte zum Bäcker und ließ Kuchen holen. Über das Nachspiel ist nichts bekannt.
Wilhelm, ein jüngerer Bruder Adolfs aus der zweiten Ehe seines Vaters, bereiste als Handelskapitän die ganze Welt und sorgte für Überraschungen und für ein leicht exotisches Flair im Haushalt. Meta liebte ihn, denn wenn er zu Besuch kam, umwehte ihn ein Duft der großen weiten Welt. Er erzählte von China, von Südamerika und Afrika, von Kap Horn und riesigen Wellenbergen, von Schiffbrüchen, seltsamen Menschen und Tieren. Er zog die Kinder in seinen Bann, und wenn er wieder wegfuhr, hinterließ er ein Gefühl absoluter Leere. Durch Wilhelm kamen allerlei fremdländische Dinge ins Haus. Zum Beispiel ein grüner Papagei in einem großen Käfig. Der wartete förmlich darauf, daß die Türglocke bimmelte oder das Telefon läutete (Adolf war einer der ersten in Forst, der so einen Apparat hatte), dann schrie er mit krächzender Stimme: „Herein!“. Oder er rief: „Trari, trara, die Post ist da“ oder „Papa kommt!“, manchmal auch nur den eigenen Namen „Lora, Lora!“ oder „Lora ist lieb!“. Nachdem Lora nach vielen Jahren in den Tierhimmel eingegangen war, wurde sie ausstopft und auf die Kommode gestellt, damit sie der Nachwelt erhalten blieb.
Für die Mädchen brachte Onkel Wilhelm schöne Korallenketten mit, feine, aus Muscheln geschnitzte Gemmen, duftige, leichte bunte Schals, herrlichste Seidenstoffe, Broschen aus Elfenbein in Filigranarbeit, perlenbestickte Pantöffelchen und große Muscheln, in denen man das Meer rauschen hörte. Aus Hongkong brachte er für Adolf einen kuriosen Zigarrenständer mit, denn Adolf war Zigarrenraucher, und für Emma ein schwarzes Lackschränkchen, üppig mit bunten Drachen und Chrysanthemen bemalt und mit vielen kleinen und größeren Schüben hinter den Türen für Gewürze oder Arzneien. Von Wilhelm stammten auch die großen Chinavasen, die in der guten Stube rechts und links neben dem Spiegel standen, und der Wandschirm im Schlafzimmer.
Mal schickte er ein Fässchen schweren, süßen Wein aus Malaga, mal ein Fässchen Rum aus Jamaika oder Kaviar aus Russland. Die Jungen erfreute er mit Federschmuck aus Amerika, Negertrommeln, Pfeil und Bogen aus Afrika, buntem Glasschmuck, Zinnsoldaten in bemalten Spanschachteln und beweglichem Blechspielzeug. Onkel Wilhelm brachte Lichtpunkte in den tristen Alltag. Die Kinder jubelten, wenn er sich ankündigte, und die kleine Meta himmelte ihn an. Er war so ganz anders als der Vater: lustig und leutselig, und sie hatte keine Scheu vor ihm wie vor Adolf. Wilhelm verstand es, auf die Kinder einzugehen, und Meta durfte auf seinem Schoß sitzen, wenn er sein Seemannsgarn spann. Er blieb der einzige, den sie aus der großen Geschwisterschar ihres Vaters kennen lernte; mit ihren Großeltern traf sie nie zusammen - weder mit denen väterlicherseits in Metzingen noch mit Emmas Mutter in Hückeswagen. Man schrieb sich zwar gelegentlich Festtagsgrüße mit einem Onkel, der in Süddeutschland ein großes, von oben bis unten bemaltes Hotel besaß, aber man besuchte sich nie. Einmal muß Adolf aber doch noch in seiner Heimat gewesen sein, denn in einem alten Pass fand sich ein Stempel, der bewies, daß er nach Württemberg eingereist war.
Viermal in jedem Jahr lastete auf Emma eine wichtige Heidenarbeit: die große Wäsche. Die Riesenvorräte von frischen Bettbezügen, Kissen, Laken, Handtüchern, Tischwäsche und Servietten waren aufgebraucht, lagen benutzt und schmutzig in Weidenkörben. Lange Zeit vor dem großen Ereignis bestellte Emma die Waschfrau und ermahnte sie kurz vor dem vereinbarten Termin noch einmal, ja pünktlich zu erscheinen. Meta freute sich immer, wenn es wieder soweit war, denn an den Waschtagen wurde ein besonders kräftiges Essen auf den Tisch gestellt und in den Kaffee kamen mehr Bohnen als Zichorie. Eine Waschfrau mußte schließlich etwas poussiert werden, weil sie noch in viele andere Haushalte zum Waschen ging, und Emma wollte sich nichts nachreden lassen.
Die Waschküche mit ihrem riesigen Kupferkessel, mit den Wannen, Fässern und Zubern lag im Keller. Da wurde am ersten Tag sortiert, in Sodawasser eingeweicht und abends vorgeheizt. Am zweiten Tag mußte die Wäsche portionsweise gekocht und auf dem Rubbelbrett gewaschen werden, bis die Hände aufgequollen und durchgeschunden waren. Es gab nur Kern- und Schmierseife. Hatte man diese Strapazen hinter sich, wurde gespült und in frischem Wasser klar gekocht. Gechlort und gebleicht wurde - wenn nötig - am dritten Tag und dann gespült, gespült und nochmals gespült - bis zum Gotterbarmen und noch dazu in eiskaltem Wasser. Endlich kam alles in die gute Hoffmanns Wäschestärke oder - in schlechten Zeiten - in einen Zuber mit Kartoffelmehl leicht angedickten Wassers. Nun konnte ausgewrungen werden. Dazu kam noch jedes Mal die Zugehfrau, die öfter bei Emma aushalf, wenn Not am Mann war. Mit aller Kraft drehten die beiden Frauen die Wäschestücke einzeln zu festen Würsten, um das Wasser so gut wie möglich rauszudrücken. Deswegen mußte die Waschfrau gesund und kräftig sein, sonst taugte sie nichts, und mit deftigem Essen sollte sie bei Laune gehalten werden.
Am Ende dieses Tages atmeten die Frauen auf, aber zu Ende war die Prozedur noch lange nicht. Jetzt schleppte man die ausgewrungene, aber natürlich noch nasse und bleischwere Wäsche in Körben auf den Trockenplatz, etliche Grundstücke weiter in die Sorauer Straße hinein. Der Trockenplatz, eine schöne weiche, gepflegte Wiese, eingezäunt, damit er nicht beschmutzt wurde oder etwa Kinder dort spielten, mußte schon viele Wochen vorher bestellt werden. Hier hängte man die meiste Wäsche auf lange, gespannte Leinen, befestigte sie mit Holzklammern und unterstützte die nun schwer belasteten Wäscheleinen, damit sie nicht durchhingen oder gar rissen, mit so genannten Wäschestützen. Das waren eigentlich nur leichte Bretter, die oben eine Kerbe hatten, in die die Leine kam, und das untere Ende wurde auf dem Erdboden festgesetzt.
Lustig flatterte alles im Wind. Andere Wäschestücke wurden zum Bleichen auf der Wiese ausgebreitet und, wenn sie trocken waren, mit reinem Wasser aus einer Gießkanne begossen. Das wiederholten die armen Frauen mehrmals und rangen heimlich die Hände und flehte die guten Geister an, daß sie den Regen vertrieben und keinen Wind duldeten, der Dreck aufwirbelte. Man war glücklich, wenn die Sonne schien und eine angenehme Brise wehte. Herrschte während der Waschtage nämlich schlechtes Wetter, mußte die gesamte Wäsche gleich auf den großen Trockenboden im eigenen Haus gebuckelt werden. Natürlich war der Trockenplatz viel beliebter, weil die Wäsche nach dem Trocknen im Freien so herrlich frisch duftete.
Schien endlich alles trocken, wurde die Wäsche, gleich schön zusammengelegt, nach Hause geschleppt. Tags darauf zogen und zottelten wieder zwei Frauen jedes Stück erst in die schräge und dann in die gerade Richtung, um es in Form zu bringen, und legten es dann sorgfältig, Ecke auf Ecke, Kante auf Kante, für die Rolle zurecht. Die Rollen waren eine neue und beliebte Errungenschaft für die Hausfrau und standen meist im Keller von Seifengeschäften - große schwere Ungetüme, die der geplagten weiblichen Welt die mühsame Handplätterei der Bett- und Tischwäsche ersparten. Jedes große Wäscheteil wurde um die Hälfte zusammengefaltet, leicht eingesprengt und um eine etwa eineinhalb Meter lange Holzrolle gewickelt - Lage auf Lage, bis die Rolle einen Durchmesser von ungefähr dreißig Zentimeter hatte.
Jeweils zwei dieser Rollen mußten dann in einen gewaltigen Kasten geschoben werden, dessen schweres Oberteil sich durch Heben oder Senken bewegen ließ und beim Senken die Wäscherollen einklemmte. Um den Mechanismus der Maschine in Gang zu setzen, mußte unter ziemlicher Anstrengung ein großes Rad gedreht werden, welches das gewaltige Oberteil ächzend und quietschend auf dem Unterteil hin und her schob und die Rollen von einem Ende zum anderen bewegte. Die ungeheure Last mangelte die Wäsche wunderbar glatt. Hatte man das Gefühl, die Wäsche sei nun fertig, wurde das Monster ausgestellt, das Oberteil abgehoben, jede Wäscherolle herausgezogen, und zwei neue, vorbereitete Rollen wurden eingelegt. In späterer Zeit gab es dann elektrisch betriebene Rollen. Das wurde den Haus- und Waschfrauen auf großen Werbeplakaten vor dem Geschäft angekündigt und war ihnen wiederum eine große Erleichterung.
Wer nun glaubt, die große Wäsche wäre ausgestanden, irrt sich gewaltig. Alle feineren Stücke wie Hemden, spitzenbesetzte Unterhosen und Unterröcke, die schon beim Waschen eine vorsichtige Sonderbehandlung erhalten hatten, mußten in tagelanger Arbeit mit dem Bügeleisen, das unermüdlich mit einen glühenden Bolzen bestückt wurde, geplättet werden. Adolfs Hemden, lose Kragen und Vatermörder brachte Emma jedoch zu einer Plätterin, die sie mittels Mengen von Stärke ganz steif bügelte. Sie wohnte auch in der Sorauer Straße, schräg gegenüber. Wenn es mal passierte, daß nach Adolfs Meinung ein Kragen nicht tadellos geplättet und gestärkt war, kriegte er einen Wutanfall und riss sich das Ding vom Hals, daß die Knöpfe in alle Himmelsrichtungen sprangen.
Nach der tagelangen Prozedur waren die hohen Stapel blütenweißer, fein gefalteter Wäsche Emmas großer Stolz. Sie sortierte sie in Schränke, deren Zwischenbretter ausnahmslos mit den von Meta gehäkelten Spitzen verziert waren und strich liebevoll mit der Hand über das glatte Linnen - manchmal liebevoller als über die Köpfe ihrer Kinder. Gefüllte Wäscheschränke entzückten das Herz jeder Hausfrau. Viel Wäsche bedeutete in damaliger Zeit ein Statussymbol. „Viel Wäsch', viel Ehr.“
Über eine Woche hatte die große Wäsche gedauert. Aus heutiger Sicht betrachtet, muß es eine schreckliche Woche gewesen sein.
Wie ich schon einmal erwähnte, fuhren Emma und Adolf gelegentlich nach Cottbus ins Theater oder ins Konzert. So auch einmal, als die kleine Meta im zehnten Lebensjahr stand. Ihre etwas ältere Schwester Emma durfte eine Freundin besuchen und dort länger bleiben als gewöhnlich. Otto, der Bruder, sollte sie zu einer fest verabredeten Zeit abholen, denn es gehörte sich nicht, daß ein junges Mädchen nach Einbruch der Dunkelheit alleine auf der Straße war. Zu dieser Zeit schlummerte Meta und der kleinere Walter schon in ihren Betten. Otto las in einem Buch; er las für sein Leben gern. Er las und las, und die Welt um ihn versank. Als er zu sich kam, den Kopf hob und auf die Uhr sah, packte ihn das Entsetzen. Es war viel zu spät - der verabredete Termin längst überschritten. Otto wußte, daß seine Eltern auf irgendeine Weise von seinem Versäumnis erfahren würden. In der Verzweiflung über seine eigene Unzuverlässigkeit und aus Angst vor der Strenge des Vaters ging er in seiner grenzenlosen Einsamkeit und Not in das kleine Ställchen an der Rückseite des Hauses und erhängte sich.
Emma, die vergeblich auf den Bruder wartete, wurde schließlich von jemand anderem nach Hause begleitet. Als die Eltern aus Cottbus zurückkamen, schimpften sie fürchterlich, weil Otto nicht da war. Stunde um Stunde verging, und Otto kam nicht. Da wurden sie stiller und stiller und sorgten sich. Nachdem der Sohn morgens immer noch nicht da war, suchten sie das ganze Haus ab, jeden Winkel im Keller und auf dem Boden - bis sie ihn endlich im Ställchen fanden.
Ich habe oft über Ottos Tod nachgedacht. In welcher Panik muß der arme Junge gewesen sein wegen einer Nichtigkeit. Woraus hätte seine Strafe bestanden? War sie so furchtbar, daß Otto lieber den Tod wählte? Wen ich fragen konnte, habe ich ausgehorcht. Keiner wußte es. Hatte die Strafe etwas mit dem Kantschu zu tun, einer kurzen russisch-türkischen Peitsche mit sieben Lederstreifen, die in der Küche hing? Die auch ich noch kannte und über die ich mich immer wunderte, weil ich nicht wußte, warum sie dort hing. Züchtigte Adolf seine Kinder damit? Ich vermute es, denn Otto muß fast irrsinnig vor Angst gewesen sein. Wie hätte Emma sich verhalten? Wußte Otto, daß er an ihr keine Hilfe gehabt hätte? Hätte seine Mutter ihn nicht mit ihrem eigenen Leib vor der Gewalttätigkeit des Vaters geschützt? Wir werden es nie mehr erfahren, aber ich will auch nicht, daß Otto vergessen wird.
Noch im gleichen Jahr erkrankte Emma, damals 12 Jahre alt, an einer Blinddarmvereiterung und wurde im Forster Krankenhaus operiert. Die Operation überstand sie gut, aber in der folgenden Nacht, als die Nachtschwester unaufmerksam war, griff sie heimlich zu einem Glas Wasser und trank es aus, weil ein wahnsinniger Durst sie quälte. Etliche Stunden später verstarb sie.
So hatten Emma und Adolf in einem einzigen Jahr gleich zwei Kinder verloren. Von den ehemals zehn Kindern lebten nur noch Wilhelm, der Erstgeborene, Bruno, Meta und Walter, der Letztgeborene.
Meta wuchs heran und flitzte im Winter mit ihrer Busenfreundin Lieschen auf Schlittschuhen über die zugefrorene Neiße oder die in Eisbahnen verwandelten Sportplätze. Untergehakt oder die Arme vorne überkreuzt und an den Händen gefasst, sausten sie in lang ausholenden Schritten dahin. Ganz verstohlen fingen sie an, nach heimlichen Verehrern Ausschau zu halten. Ihre Bewegungen wurden graziöser, und sie entwickelten sich zu hübschen jungen Mädchen. Lieschen war stämmiger und größer als Meta. Meta blieb zierlicher, war aber wohlproportioniert, hatte alles an der richtigen Stelle. Reizend müssen die beiden beim Eislauf ausgesehen haben. Sonntags wurde mitten auf dem Eis ein Pavillon aufgebaut, in dem eine Musikkapelle schmissige Weisen spielte oder Tanzmusik, der sich die Eisläufer im Rhythmus anpassten. Es gab heiße Schokolade und Glühwein zu kaufen. Das erste Glas Glühwein ihres Lebens, zu dem Meta auf der Eisbahn eingeladen wurde, ist ihr unvergeßlich geblieben. Nie wieder hat ihr ein Glühwein besser geschmeckt als dieser.
Sexualität schwieg man damals einfach tot als gäbe es sie überhaupt nicht. Kein Mensch klärte Meta auf. Über diese Angelegenheit sprach man nicht. Nicht einmal über die natürliche Entwicklung des Köpers verlor man eine einzige Silbe. Als Meta ihre Tage bekam, fiel sie vor Schreck fast in Ohnmacht, denn sie glaubte an eine schwere Krankheit. Lieschen, pfiffiger und nicht so hinter dem Mond wie Meta, spielte jetzt die große Beraterin. Sie weihte Meta in alle Geheimnisse ein - wirklich in alle. Meta war fasziniert.
Für die moderne Frau mit den Hilfsmitteln der heutigen Zeit ist die Periode keine allzu lästige Sache. Aber als Meta ein junges Mädchen war, etwa 1910, war sie eine Katastrophe, eine Strafe. Die Frauen benutzten hauptsächlich Naturschwämmchen, die aber dauernd ausgespült und zwischen Tüchern trocken gedrückt werden mußten, stopfte sie entweder in die Scheide oder legte sie davor. Oder die Frauen nahmen gestrickte oder gehäkelte, doppelt gelegte Binden, die an einem extra Gürtelchen befestigt wurden. Nach dem Gebrauch wurden sie gespült und ausgekocht und an versteckten Orten getrocknet, denn kein Männerauge durfte sie erblicken. Die Menstruation blieb geheimste Frauenangelegenheit; man tat so, als gäbe es keine.
1910 feierte Meta ihren fünfzehnten Geburtstag. Die Berliner hatten gerade ihren ersten Zeppelin über ihrer Stadt gesehen; es war der dritte, der in Deutschland gebaut wurde. Die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf hatte ein Jahr vorher den Nobelpreis für mein Lieblingsbuch „Nils Holgersohn“ und für „Gösta Berling“ verliehen bekommen. Katharina Kruse, die 27jährige Frau eines Bildhauers und Professors aus der Berliner Fasanenstraße 13 gewann mit ihren selbst gefertigten Puppen den Wettbewerb „Spielzeug aus eigener Hand“ - die Käthe-Kruse-Puppen erblickten so das Licht der Welt. Joghurt aus Bulgarien eroberte den deutschen Markt. Der erste Verbrecher, der mit Hilfe der drahtlosen Telegrafie gefasst wurde, ist ein Dr. Crippen, der gerade eine große Schiffsreise unternahm. In Berlin eröffnete der Sportpalast. Die Frauen kämpften um ihr Wahlrecht; seit zwei Jahren durften sie in Deutschland endlich studieren. In Amerika starb Mark Twain, in Deutschland Wilhelm Raabe und in Russland Leo Tolstoi.
Und in Forst tauschten zwei junge Mädchen verstohlen Geheimnisse aus. Lieschen erzählte, daß es in Cottbus Strichmädchen gibt, und die wollten sich beide für ihr Leben gerne ansehen. Welche Ausrede sie gebrauchten und wie lange sie ihre Eltern beknieten, um die Erlaubnis zu bekommen, mit der Eisenbahn nach Cottbus zu fahren, ist nicht überliefert. Eines Tages jedenfalls durften sie fahren. Die Eltern studierten die Fahrpläne ganz genau, und die Zeiten der Abfahrten mußten gewissenhaft eingehalten werden. Emma und Adolf hatten ja nicht die leiseste Ahnung, was die beiden Mädchen nach Cottbus lockte, nämlich die Strichmädchen. Und die fanden sie schließlich auch, denn Lieschen war bestens informiert, und dank ihrer Allgemeinbildung sahen sie die Damen an den Ecken stehen und auf Kundschaft warten. Meta muß wohl vergessen haben, den Mund zuzumachen vor lauter Staunen, denn einer der Damen wurde das Angestarre zu viel. Wütend schmiß sie ihre Boa fester um die Schultern und zischte: „Du hast leider kein Gesicht dafür!“. Meta klappte den Mund vollkommen irritiert zu und fuhr erschreckt nach Forst zurück.
Zu den schönsten Erlebnissen aus Metas Jugendzeit gehörten mehrere länger dauernde Reisen nach Hamburg in das Haus von Onkel Wilhelm in der Kastanienallee 3, nicht weit von der Großen Freiheit. Wilhelm war zu dieser Zeit nicht auf Fahrt und widmete sich ausschließlich seiner Familie und dem jungen Gast. Seine Frau, die elegante, liebreizende Tante, und zwei lustige Töchter in Metas Alters nahmen sich ihrer an. Meta war begeistert und entzückt von der Fröhlichkeit ihrer Verwandten. Hier lief alles anders als in ihrem Elternhaus, das eher prüde und spießbürgerlich war, in dem man nicht laut und übermütig lachte. Über Meta, die von nichts eine Ahnung hatte, brach eine Aufklärungswelle in bezug auf Kunst- und Lebensanschauungen herein.
Der Onkel schleppte sie durch sämtliche Museen, Gemäldegalerien und Ausstellungen, zu Sehenswürdigkeiten, in Kaffees und feinste Esslokale - Meta sollte unbedingt alles kennen lernen. Ihre Garderobe wurde der Mode besser angepasst, und stundenweise durften die Mädchen nur französisch sprechen. Irgendwie muß in Onkel Wilhelm auch ein kleiner Schelm gesteckt haben. Er trieb sehr viel herzlichen, liebevollen Unsinn mit seinen vier hübschen Frauen. Manchmal ging er auch gern mit seiner Nichte allein aus. Einmal versprach er ihr etwas ganz besonderes und führte sie in das berühmte Panoptikum. Hier waren, aus rosa Wachs geformt, die getreuen Nachbildungen berühmter oder berüchtigter Leute ausgestellt. Und auch nackte Menschen, ganz ohne Feigenblätter nicht mit den Händen vor den edelsten Körperteilen - einfach nur so, wie der liebe Gott sie sich ausgedacht hat. Vor denen verweilte der Onkel besonders lange und gab einige harmlose Erklärungen ab. Meta wurde abwechselnd rot und blaß und wand sich vor Scham fast wie ein Regenwurm. Als Onkel Wilhelm gar nicht aufhörte gerade diese Wachsfiguren anzusehen, fühlte sie sich einer Ohnmacht nahe und konnte die Schwäche nur durch bewusst tiefes Ein- und Ausatmen überwinden.
Anschließend gingen beide in ein Kaffeehaus, um sich zu stärken, und Meta fühlte nach einem Weilchen ein menschliches Bedürfnis. Sie hätte gerne mal das nötige Örtchen für Damen aufgesucht, wußte aber, daß das etwas kosten würde und sie ihr Geldtäschchen vergessen hatte. Langsam kam der Punkt, an dem sie es kaum noch aushielt, und sie fing an, auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen; in ihrer Verklemmtheit getraute sie sich nicht, einen Ton zum Onkel zu sagen. Endlich hörte der aber die Nachtigall trapsen und schob ihr lächelnd, heimlich und mucksmäuschenstill mehrere Groschen zu. Meta nahm sie - hold errötend, aber schnell - und verschwand eiligst.
Die Tante erregte Metas größte Bewunderung, denn sie kleidete sich stets mit Schick und Eleganz. Beim Bummel durch die Geschäftsstraßen, hielt sie sich, um die Modeauslagen zu begutachten zu können, ein Lorgnon mit einem kunstvoll verzierten Stiel vor die Augen. Das imponierte Meta mächtig.
Der Aufenthalt bei diesen liebenswürdigen Verwandten verging ihr immer viel zu schnell.
Adolf hielt nicht viel von gebildeten Frauen, die er respektlos Blaustrümpfe nannte. Und irgendwann war Metas Schulzeit beendet. Sie lernte anschließend weiter in einem Handarbeitsgeschäft die kunstvollsten Stickereien, mit denen sie sich schon in der Kinderzeit beschäftigten mußte. Das Geschäft lag in der Cottbusser Straße, und darüber stand in großen Buchstaben „Elise Kühnel“.
Wilhelm, der Erstgeborene, heiratete schon um 1910. Vorher war er mit einem netten Mädchen verlobt, das Emma und Adolf sehr gefiel. Die zweite Braut, von allen Hedi genannt, stieß daher auf große Ablehnung. Dazu stammte sie auch noch aus Österreich. Eine Ausländerin! Österreich - das lag so weit weg, und man konnte nichts über ihre Familie erfahren. Emma und Adolf hegten und pflegten ihren Groll gegen die Schwiegertochter bis ins hohe Alter; sie nahmen Hedi nie an, lehnten sie ab bis an ihr Lebensende. Aber Hedi blieb ihnen nichts schuldig, sie war auch ein kleiner Drachen und zahlte den beiden alles heim. Aus der Ehe gingen zwei Mädchen hervor: Magda und Ilse. Wilhelm zog mit seiner Familie später in die Wohnung über der seiner Eltern in der Sorauer Straße in die erste Etage.
Unterdessen entwickelt sich Meta zu einem sehr hübschen jungen Fräulein, das von Verehrern umschwärmt wurde. Zeitweise muß auch ein rechtes Teufelchen in ihr gesteckt haben, denn einmal, als sie eine Verabredung hatte und der Kavalier sich verspätete, schlug sie ihm, als er endlich kam, die Blumen, die er mitgebracht hatte, um die Ohren, bis keine Blütenköpfe mehr dran waren.
1912, Meta war siebzehn Jahre alt, kollidierte der Luxusdampfer „Titanic“ auf seiner Jungfernfahrt mit einem Eisberg und riss 1503 Menschen in die Tiefe des Meeres. Dabei galt die „Titanic“ als unsinkbar und war der Stolz Englands.
1913 nahm die gesamte Familie Gerst an einer Veranstaltung auf der Wehrinsel teil. Mit einer Rosenausstellung eröffnete der Rosengarten.
1914, als Meta neunzehn Jahre war, wurde der österreichisch-ungarische Thronfolger in Sarajewo durch Schüsse getötet. Europa machte mobil. Am 1. August rief Kaiser Wilhelm II den Krieg aus und begeisterte die Deutschen geradezu mit seiner Kriegserklärung. Vor dem Berliner Stadtschloss hatten sich die Menschen erwartungsvoll versammelt, und als sie hörten, es ist Krieg, stimmten sie begeistert den Choral „Nun danket alle Gott“ an. Der Jubel der Verblendeten kannte keine Grenzen. Man glaubte, die Feinde in spätestens acht Wochen siegreich schlagen zu können.
Bittere Jahre folgten. Bruno, der nach dem Abitur in Cottbus zum Kaufmann ausgebildet wurde, bekam sofort einen Einberufungsbefehl. Er nahm den Abschied sehr schwer. Er haßte den Krieg und wollte nicht Soldat werden, aber wenn der Kaiser rief, mußte man folgen. Walter, der noch keine achtzehn Jahre alt war, wollte sich freiwillig melden, bekam aber von Adolf keine Erlaubnis.
Die Geschwister hingen in zärtlicher Liebe aneinander. Aus den ersten Kriegstagen sind noch mehrere Karten und kurze Briefe in meinem Besitz, die Bruno aus dem Feld an seine Schwester Meta geschrieben hat. Dann kamen keine Karten mehr. Bruno war tot. Über die genauen Umstände seines Todes gibt es widersprüchliche Überlieferungen. Fest steht, daß er hohe Spielschulden hatte, die er nicht begleichen konnte. Er war auch einmal auf Urlaub im Elternhaus und bat Adolf, ihm zu helfen. Der Vater verweigerte ihm das, und Bruno suchte Hilfe und Geld bei seinem Bruder Wilhelm. Auch der wollte oder konnte ihm nicht helfen. Für Bruno gab es keinen Ausweg. Spielschulden waren Ehrenschulden. Ein Teil der Familie sagte, Bruno habe sich selbst erschossen, ein anderer Teil behauptete, daß er während eines Sturmangriffs, als die Kompanie im Schützengraben in Deckung lag, aufgesprungen sei, ohne Grund, ohne Befehl, sich aufgerichtet habe und auf der Stelle vom Feind erschossen worden sei. Bruno war also tot - der zweite Sohn von Emma und Adolf, der Selbstmord begangen hatte. Jetzt lebten von den zehn Kindern nur noch drei: Wilhelm, Meta und Walter. Adolf war jetzt 65 Jahre alt, hatte seinen Direktorposten aufgegeben und handelte mit Textilrohstoffen, Emma war 56.
Die Bitterkeit des Krieges ging auch an Walter nicht vorüber. In seinem erhalten gebliebenen Kriegstagebuch steht:
„Nachdem schon längere Zeit von der Einberufung meines Jahrsgangs die Rede gewesen ist, erhalte ich denn auch durch öffentliche Ankündigung die Aufforderung, mich am 16.11.1915 im Schützenhause zwecks Musterung zu stellen. Als eifriger Turner und Sportsmann war ich sicher, daß ich für tauglich befunden werden würde, und ich täuschte mich nicht. Mit einer großen Anzahl Schicksalsgenossen gleichen Alters trat ich den Weg zum Schützenhause an. Von Anfang an war ich entschlossen, falls ich zu einer anderen Waffe als Infanterie gemustert werden sollte, mich „freiwillig Infanterie“ zu melden. Ich hatte das jedoch nicht nötig, denn nach unglaublich kurzer Untersuchung wurde ich als Infanterie kriegsverwendungsfähig (K.v.) erklärt.
Bei Kriegsbeginn hätte man es wohl nicht für möglich gehalten, daß mein Jahrgang noch mit ins Feld müsste, und dennoch war der Tag, an dem ich des Kaisers Rock anziehen sollte, nunmehr in große Nähe gerückt. Und man konnte diesen Tag auch kaum erwarten, trotzdem sich schon immer mehr der guten Mahner einstellten. ‘Drängt euch nicht danach, ihr werdet es noch schnell genug überbekommen’. Nachdem man aus der sicheren Heimat die Heldentaten unserer Herrn in Ost und West mit voller Anteilnahme verfolgt hatte, ist es erklärlich, daß mein junger stürmender Geist die Zeit kaum erwarten konnte, in der ich selbst ein Glied der Millionenkette, die das Vaterland umschloss, geworden sei.
So erhielt ich am 25.2.1916 den Bescheid, daß ich mich am 2. März im Schützenhause zu Guben zu stellen habe. Bereits vorher hatte ich mir einen sogenannten Soldatenkoffer, eine verschließbare Holzkiste, machen lassen. Der Abschied von zu Haus fiel nicht schwer, da ich begründete Hoffnung hatte, nach Cottbus in Garnison zu kommen und ich dann meine Angehörigen recht oft sehen würde. In Guben wurden wir auf die verschiedenen Regimenter verteilt. Wie vorausgesehen, kam ich zum Regiment 52 nach Cottbus und wurde mit mehreren Forstern noch am selben Vormittag dorthin befördert.
Jetzt beginnt nun das Rekrutenleben mit seinen Leiden und Freuden. Gleich am ersten Tag avanciere ich zum Stubenältesten und brauche daher kaum Stubendienst machen. Im großen und ganzen bin ich wohl einer der besten Soldaten gewesen, denn ich war mit Lust und Liebe dabei, da ich ja die ganze Sache noch durch die goldene Brille der Jugend sah. Wirkliche Strapazen hatte ich während meiner Ausbildungszeit auch kaum durchzumachen, da ich gesund und kräftig war.
Papa, Mama und Meta kamen sehr oft herüber, und auch ich hatte sehr oft Urlaub, wenn auch nur über Sonntag ... ...“
Walter kam nach Frankreich, und seine Einstellung zum Krieg erfährt eine vollkommene Veränderung. Sein Tagebuch schließt am 11.1.1919 mit folgenden Worten:
„La guerre a fini!
Ein neues Leben beginnt. Als unfertiger Jüngling zog ich hinaus in den Krieg, bekannt mit Hunger und Durst, von tausendfältigen Gefahren bedroht, hunderttausendfachem Tod entronnen kehre ich in die Heimat zurück: ein stiller, verschlossener, am Guten im Menschen zweifelnder ernster Mann. Der fürchterlichste, menschenfressendste aller Kriege hat mich verschont. Grund genug, der über uns herrschenden Allmacht steten Dank zu sagen.“
Wilhelm, der älteste Sohn, brauchte nicht in den Krieg zu ziehen. Bei der Musterung stellte man fest, daß er an einem schweren Herzfehler litt, und die Familie war sich im Unklaren, ob sie darüber froh oder unglücklich sein sollte.
Zurück zum Jahr 1916: Meta feierte ihren einundzwanzigsten Geburtstag und ging im verborgenen fleißig dem Studium der Liebe nach.
Hinterlistig, wie das Leben nun einmal ist, bereitete es einen neuen Schlag gegen Emma und Adolf vor: in der Mitte des Kriegsjahres 1916 gestand Meta, daß sie schwanger war. Der Vater des zu erwartenden Kindes hieß Walter Gottlieb und war nicht nur ein echter Hallodri, er war auch nur Buchhalter, und damit konnte sich Adolf nicht abfinden. Für seine Tochter müsste es einen standesgemäßeren Mann geben, dachte er. Also verbot er kurzerhand die Heirat - obwohl Meta großjährig war. Lieber wollten Emma und Adolf das Kind selbst aufziehen, als ihre Tochter diesem Walter Gottlieb zu geben. Sie reagierten großherziger als man vermuten könnte und verstießen Meta nicht; sie durfte im Elternhaus bleiben - trotz des Spießrutenlaufens in der kleinen Stadt Forst.
Die Nachbarn tuschelten“ „Meta Gerst kriegt ein uneheliches Kind.“. Emma und Adolf standen zu ihrer Tochter. Am 9. Januar 1917 gebar Meta in dem etwas kleineren Zimmer der elterlichen Wohnung, gleich neben der Haustür, ihr Töchterchen Eva. Fast auf den Tag genau bekam noch eine andere junge Frau ein kleines Mädchen, eine Halbschwester von Eva, denn der Vater war auch Walter Gottlieb. Die beiden kleinen, fast gleichzeitig geborenen Mädchen blieben nicht die einzigen Halbschwestern, Evas Vater hat noch mehr uneheliche Kinder in Forst in die Welt gesetzt.
Vorerst wohnte Meta mit ihrem Töchterchen bei den Eltern. Das Leben ging weiter. Meta war jung, hübsch und aus gutem Hause. Es fehlte trotz des unehelichen Kindes nicht an Bewerbern. Nicht lange nach Evas Geburt heiratete sie einen Herrn Hugo Otto Ernst Alfred Jurtz aus sehr guten Verhältnissen. Seine angesehene Familie stammte aus Sommerfeld; der Vater übte den Beruf eines Obergerichtsvollziehers aus und wurde später Zuchthausdirektor in Cottbus. Der junge Bräutigam, eine hohe, sehr gut aussehende Erscheinung mit dunklen Locken, ein ganzes Teil älter als Meta, war Architekt in Cottbus. Emma und Adolf fiel ein Stein vom Herzen, als Meta unter die Haube kam. Ich kenne noch das Hochzeitsbild, das eine strahlende junge Frau in Kranz und Schleier zeigte, leider ging es verloren. Meta bekam eine Aussteuer wie es sich gehörte: einen Batzen Geld und die Wohnungseinrichtung, bestehend aus Salon, Esszimmer, Schlafzimmer und Küche, sowie Wäsche für Jahre, Geschirr usw. - was so alles zu einem bürgerlichen Hausstand gehörte. Das junge Paar zog nach Cottbus - ohne die kleine Eva. Metas Tochter blieb bei den Großeltern, und die schenkten ihr alle Liebe, zu der sie fähig waren, und die Zärtlichkeiten, die sie ihren eigenen Kindern vorenthalten hatten.
Adolf und Emma hatten sich verändert. Sie waren milder, toleranter und liebevoller geworden. Das Leben hatte ihnen übel mitgespielt, hatte ihnen die Schärfe des Charakters genommen. Adolf züchtigte nicht mehr. Jetzt konnte er plötzlich lieben. Er wiegte die kleine Eva in den Armen und sorgte sich um Walter, der an der Front stand. Walter war immer der Lieblingssohn der Eltern gewesen; nun hatten sie noch einen Liebling: das kleine Evchen. Adolf wandte sich mehr der Kirche zu, ging jetzt regelmäßig sonntags zum Gottesdienst. Emma konnte nicht mitgehen, sie koche das Essen, sagte sie zur Entschuldigung. Ihr Motto war sowieso „Bist du in Not, so hilf dir selber“ und „Wer auf Gott vertraut, der hat auf Sand gebaut“.
Emma hatte lange nicht gesungen, aber nun, durch das kleine Evchen, sang sie wieder. Ihr Lieder waren jedoch andere geworden, waren schwermütige Lieder. Sie haderte zwar mit Gott und besuchte sein Haus nur selten, trotzdem sang sie „So nimm denn meine Hände und führe mich“ oder „O wie ist es kalt geworden, und so traurig, öd und leer“.
Irgendwann im Laufe der Zeit hatte Adolf den Instinkt für Geld verloren. Seine Kaisertreue kam ihn teuer zu stehen, als er dem Aufruf „Gold gab ich für Eisen“ folgte. Einen dicken Beutel mit 250.000 Goldmark - die gesparte Rücklage für das Alter - opferte er und bekam dafür fast wertloses Papiergeld und Eisenklimpermünzen. Dabei war er selig über die große Summe, die er für sein gutes Gold erhielt, und bemerkte den Schwindel nicht einmal. Eine regelrechte Gier überkam ihn - er wollte Scheine, Scheine und noch mehr Scheine und machte Anstalten, das Haus zu verkaufen. Da wurde Emma bald verrückt vor Empörung, uns sie behielten das Haus. Aber er verkaufte aus der Waschküche den riesigen Kupferkessel und wollte in seiner Verblendung auch die Messingklinken und die Fensterriegel abmontieren, um sie zu verkaufen. Emma langte es wieder, sie sprach ein Machtwort, und so wurden Klinken und Riegel auch gerettet. Doch Gold und Kupferkessel waren für immer verschwunden- Adolf zählte begeistert seine Scheine.
In dem Jahr 1917, in dem Evchen geboren ist und Meta heiratete, entwickelte sich der Krieg zu einem immer mörderischeren Ringen. An der Westfront mußten sich die deutschen Soldaten auf die Siegfriedlinie zurückziehen. Das verheerende Senfgas kam zum Einsatz. Das Elend der Soldaten ist nicht zu beschreiben, ebenso wenig wie das Elend der Zivilbevölkerung. Der Mangel an Nahrungsmitteln ließ die Preise explodieren. Die Bevölkerung hungerte. Auch in Emmas Küche wurde Schmalhans Küchenmeister. Voller Courage kämpfte sie dagegen an, fuhr mit dem Zug zum Hamstern ins Umland von Forst zu den Bauern, und tauschte immer mehr Schmuck- und Wäschestücke für ein paar Lebensmittel ein. Mit gieriger Hand nahmen die Bauern reichlich und gaben wenig. In Emmas Schränken klafften immer größere Lücken; aber sie ist tapfer, sie erträgt das alles. Die Kohlrübe ist das wichtigste Gemüse geworden, sogar Brot wurde mit einem Anteil Kohlrüben gebacken. Kohlrüben wurden zu Kaffeeersatz geröstet, Kohlrüben wurden zu fast allen Mahlzeiten gegessen, Kohlrüben hingen allen Menschen zum Halse raus, und doch kaum einer konnte auf sie verzichten; es gab kaum etwas anderes. Kohlrüben waren das Hauptnahrungsmittel 1917.
Die Tänzerin Mata Hari wurde als angebliche Spionin für Deutschland bei Paris erschossen. Im Jahr zuvor war der Mönch Rasputin ermordet worden, der einen unheilvollen Einfluss auf die Zarenfamilie ausgeübt haben soll. Lenin kehrte aus der Schweizer Emigration nach Russland zurück und entfachte die Revolution. Der Zar und seine Familie wurden nach Tobolsk deportiert und im Sommer 1918 wurden Zar, Zarin, fünf Kinder, Leibarzt, Koch und Zofe von den Bolschewisten in Jekaterinenburg erschossen. Dann, im Herbst 1918, war der Krieg vorbei. Der Kaiser hatte abgedankt und war ins Exil gegangen. Millionen Männer sind gefallen oder kamen als Krüppel nach Hause. In Deutschland brach die Revolution aus.
Walter befand sich bei Kriegsende mit seinem Regiment auf einem geordneten Rückweg in die Heimat; er ist nicht in Gefangenschaft geraten. Nach tagelangen Fußmärschen und einem Weihnachten in Eisenbahnwaggons gelangte er im Januar 1919 nach Berlin und kam in den Spartakusaufstand. Er hatte vom Krieg genug gesehen und sehnte sich laut Tagebuch nur noch nach einem friedlichen Leben.
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründeten die Kommunistische Partei Deutschlands und wurden 15 Tage später ermordet.
In diesem Nachkriegsjahr, dem Jahr der Aufstände und Unruhen, war Meta erneut schwanger und erwartete ihr zweites Kind. Aber sie fiel aus allen Wolken, und der Ehehimmel brach über ihr zusammen, denn mit Entsetzen stellte sie fest, daß sie mit dem schwarzen Schaf der Familie Jurtz verheiratet war. Das Geld der Mitgift hatte ihr Mann längst verpulvert und Salonmöbel sowie Ölgemälde einfach verkauft. Eines Tages, Meta kehrte nichts ahnend von einem Vormittagsbesuch zurück, stand ein Möbelwagen vor der Haustür, und Packer wollten gerade das Speisezimmer einladen. So schnell sie konnte, holte sie telefonisch ihren Vater zu Hilfe. Adolf veranstaltete einen Heidenkrach und ließ alle Möbel wieder in die Wohnung schaffen. Kurz darauf ist ihr Mann wegen Urkundenfälschung und der Unterschlagung beträchtlicher Summen verhaftet worden und mußte mehrere Jahres seines Lebens im Zuchthaus in Cottbus verbringen, was für seinen Vater, der ja Zuchthausdirektor in Cottbus war, eine doppelte Schande darstellte.
Meta
reichte die Scheidung ein. Mit der Familie Jurtz verstand sie sich sehr gut und
übersiedelte in deren Nähe nach Sommerfeld. Dort wurde am 27. August 1919 ihre
Tochter Emma Klara Gisela geboren, ein ausgesprochener kleiner Schreihals. Die
beiden lebten in einer bescheidenen Dachwohnung mit schrägen Wänden bei einer
Familie Thomas. Von dieser Zeit schwärmte Meta noch als alte Frau, denn sie war
voll schönster Unbeschwertheit. Herr Thomas übte das Amt eines Briefträgers aus,
und seine Frau war eine Köchin der feinen Küche, die Hochzeiten oder andere
Festlichkeiten in Privathaushalten ausrichtete. Diese beiden Leutchen, bedeutend
älter als Meta, beherrschten die Kunst der zufriedenen Heiterkeit. Hauptsächlich
Herr Thomas steckte voll spaßiger Einfälle. Einmal überredete er sie, sich auf
einen Handwagen zu setzen.
Wie er das fertig gebracht hatte, konnte sie später
auch nicht begreifen, jedenfalls saß sie kaum drauf, da trabte er los und zog
sie durch das ganze Städtchen. Meta hockte - herausgeputzt mit Hut, Schleier,
Handschuhen und Handtäschchen - im polternden Wägelchen und wußte wieder einmal
vor Scham nicht, wo sie hinblicken sollte. Laufend neckte er sie so mit lustigen
Streichen. An einem 1. April schickte er Meta an andere Ende der Stadt, und als
sie zurückkam, erwartete er sie mit einem bunten Blumenstrauß und rief „April,
April“. Alle seine Späße, seine Witze und sein Schabernack waren stets
gutmütiger Art und kamen aus freundlichem Herzen, nie verletzend oder ordinär.
Ein neuer Verehrer bewarb sich um Meta - ein ziemlich begüterter Weinhändler, der sie mit Delikatessen verwöhnte, die sie in der Inflationszeit als begehrtes Zubrot gerne annahm. Als im Januar 1922 ihre Scheidung durch war, bat er sie um ihre Hand. Aber Meta lehnte ab; er trank ihr zu viel. Daraufhin zog er sich zurück.
Emma kam mit der kleinen Eva zu Besuch und blieb einige Zeit, bis auch Adolf kam, um sie abzuholen. Später erinnerte sich Eva, daß er für die beiden Frauen Kleiderstoffe mitbrachte und für sie und Gisela ein Silberkettchen.
Meta und Gisela lebten glücklich bei Thomasens. Doch alles Schöne dauert meist nicht lange.
Walter heiratete 1921 seine große Liebe, ein Fräulein Frida Hofrichter, eine Verkäuferin aus Forst, die um etliche Jahre älter als er und deshalb seinen Eltern ein Dorn im Auge war. Aber sie ließen den Sohn gewähren. Als begabter Kaufmann arbeitete er in einer großen Tuchfabrik in Forst und wurde später gut bezahlter Prokurist bei Groeschke.
Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich rapide. Durch die Inflation verlor Adolf 1922 bis 1923 sein ganzes restliches Vermögen. Als einziger Besitz war ihm das Haus geblieben. Er konnte Meta nun beim allerbesten Willen finanziell nicht unter die Arme greifen. Aber Meta mußte leben, mußte sich und die kleine Gisela ernähren. Jetzt lernte sie sogar den Hunger kennen. Es ist ein Familienrätsel, wie sie es fertig brachte, sich durchzuschlagen. Sie besaß offensichtlich mehr Courage, als man ihrer Erziehung nach hätte vermuten können. Für sie und ihr Töchterchen begann eine jahrelange Odyssee.
Auf eine Zeitungsannonce hin bewarb sie sich um die Stelle einer Hausdame bei einem Herrn Senft, der als Häusermakler ebenfalls in Sommerfeld wohnte. Dieser schon etwas ältere Herr lebte mit seiner Schwester zusammen und suchte eine kultivierte Dame, die ihm den Hausstand führte. Er besuchte Meta, um zu prüfen, unter welchen Umständen diese ihr Leben verbrachte und wessen Geistes Kind sie sei. Meta und Gisela wurden für würdig befunden und übersiedelten in sein Haus. Die Atmosphäre dort war sehr angenehm, nur leider verstarb der nette Herr Senft nach noch nicht einmal zwei Jahren, und Meta mußte sich nach einem anderen Broterwerb umsehen.
In der elterlichen Wohnung lagerte in dem kleinen Zimmer, in dem Eva geboren war, ein Teil ihres eigenen Hausstandes, der andere Teil befand sich auf dem Speicher. Das Elternhaus wurde zu einem Zufluchtsort. Hier konnte sie, als es überhaupt nicht mehr weiterging, eine Zwischenstation einlegen, und von hier aus machte sie sich auch wieder auf die Reise. Nach Görlitz ging es jetzt. Dort suchte man eine Wirtschafterin für einen älteren Herrn mit zwei Schwestern, die einen Hutsalon betrieben. Als Meta und Gisela in Görlitz eintrafen, mußten sie zu ihrem Unglück erfahren, daß der besagte Herr inzwischen plötzlich verstorben war. Einige Monate blieben sie bei den zwei alten Damen, bis auch die ältere von beiden dahinschied. Wieder fanden sie Zuflucht bei Emma und Adolf. Auch denen ging es nicht gut; der Wohlstand war für immer dahin, die guten Zeiten vorbei. Tapfer rang Adolf als Vertreter für Garne um Geld für das tägliche Brot. Er war nun ein alter Mann, alles fiel ihm schwerer als früher. Manchmal fühlte er sich müde vom Leben, aber er durfte nicht nachgeben; er hatte doch Verantwortung zu tragen. Durch seine Vertreterbesuche mußte er nun viel reisen.
In Forst wurden Vertreter auch Agenten genannt. Man begegnete ihnen oft auf den Forster Straßen und erkannte sie an den Päckchen aus blauem Packpapier mit den Proben von Garnen, Wolle und Baumwolle, die sie unter den Arm geklemmt trugen und in den Tuchfabriken anboten. Befanden sich die Agenten auf Geschäftsreisen, mußten sie etwas weltmännischer wirken und benutzten selbstverständlich kleine Musterkoffer aus Leder.
Meta nahm ihre Zukunft und die der kleinen Gisela wieder in die eigenen Hände. Langsam traute sich immer mehr zu . Während ihrer Zeit in Sommerfeld bei Thomasens hatte Meta viel gelernt. Sie war von Frau Thomas gründlich in die Geheimnisse der feinen Küche eingeweiht worden und am Ende selbst eine exzellente Köchin. Durch die „Gartenlaube“, eine Frauenzeitschrift, deren eifrige Leserin sie war, fand sie eine neue Arbeitsstelle. Auf einem großen Gut in Grabig, im Kreis Sorau, suchte der Gutsherr, ein Witwer mit mehreren Kindern, eine Herrschaftsköchin. Um das Vieh, die Felder, den Garten und die Leuteküche hatte diese sich nicht zu kümmern, nur um das Dienstpersonal des Gutshauses und die Küche der Herrschaft. Meta wurde angenommen und übersiedelte von Forst nach Grabig - natürlich mit Gisela im Gefolge, denn Emma und Adolf hatten reichlich zu tun, sich um Evchen zu kümmern. Sie konnten nicht auch noch Metas zweites Kind aufziehen; das hätte ihre Kräfte und ihren Geldbeutel überfordert.
Meta war hübsch, jung und flink; sie stellte genau das dar, was der Gutsherr gesucht hatte. Es blieb nicht aus, daß bei dem jungen Witwer die Liebe durch den Magen ging. Er fing an, um seine Köchin herumzuscharwenzeln und wollte sie sogar heiraten. Inwieweit Meta Zugeständnisse machte, ist unbekannt geblieben. Das Schicksal hatte so ganz anders entschieden. Es begab sich zu dieser Zeit, daß ein Monteur für Landmaschinen von der Firma Krupp auf das Gut kam, um etwas zu reparieren. Er fand die flotte Wirtschafterin ausnehmend nett und adrett und liebäugelte mit ihr. Auch Meta gefiel der junge Mann, und so lud er sie zur Dorfkirmes ein, und sie nahm an. Die beiden tanzten zur Blasmusik, sie tanzten zum Klang der Fiedeln, der junge Monteur spendierte der Herrschaftsköchin ein Likörchen, und sie verliebten sich ineinander. Der Gutsherr stand am Rande der Tanzfläche und fühlte sich beleidigt und schmählich hintergangen. Und als er ihnen auf die Schliche kam, daß die beiden sich näher kamen als er erlaubte, war Metas und Giselas Bleiben auf dem Gut unmöglich geworden. Hals über Kopf verließen sie Grabig und flohen nach Forst. Der junge Krupp-Monteur hatte feste Absichten gehabt, doch die Zeit des Kennenlernens war viel zu kurz gewesen. Sie blieben jedoch in Briefkontakt.
Wieder durch die „Gartenlaube“ übersiedelten Meta und Gisela zu einem Ehepaar Ertel nach Kohlfurt. Die Frau war gelähmt und brauchte dringend eine Wirtschafterin. Geld war reichlich vorhanden. Gisela wurde zum xten mal umgeschult, und alles ging gut. Herr Ertel führte seine junge Wirtschafterin ab und zu zu harmlosen Veranstaltungen aus - einesteils aus gesundem Egoismus heraus, denn er ließ sich gern mit der hübschen jungen Frau in Begleitung sehen, andererseits auch, um ihr etwas Abwechslung zu bereiten. So wollte er Meta eines abends den Kunstgenuß eines Kinostückes nicht vorenthalten. Kino war ganz groß in Mode. Während der Vorstellung im finsteren Saal fühlte Meta plötzlich, wie sich Herr Ertel schwer gegen sie lehnte. Erst hielt sie es für einen ungeschickten Annäherungsversuch und wollte ihn abwehren. Aber Herr Ertel wurde immer schwerer, und zu ihrem Schrecken stellte sie fest, daß er besinnungslos war. Er verstarb noch im Kinosaal an einem Herzanfall.
Meta war ganz verzweifelt. Erneut hatte sie ihre Existenzgrundlage durch den Tod ihres Dienstherrn verloren. Voller Kummer schrieb sie einen jammervollen Brief an den jungen Monteur und schilderte ihm, wie es ihr ergangen war. Dieser, kurz entschlossen, fackelte nicht lange, schwang sich auf sein Motorrad und kam angereist. Er holte Meta und Gisela zu sich nach Hause in das Dorf Benau in der Nähe von Sorau und wollte sie für immer bei sich behalten, denn er liebte sie. Der junge Monteur hieß Paul Heinze und war der Neffe gerade jenes Gustav Heinze, dessen Orgel Meta als Kind so verzückt gelauscht hatte. Von ihm ließ sich Meta mit Gisela in ein neues Leben entführen.