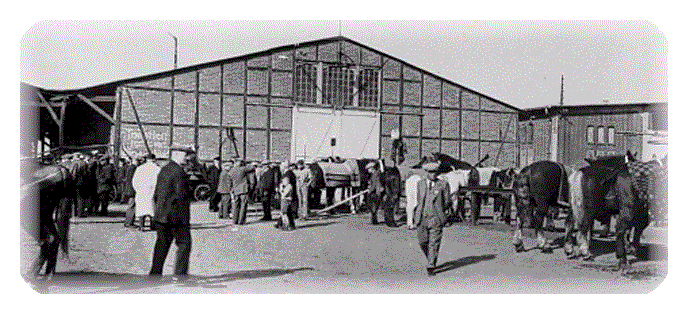
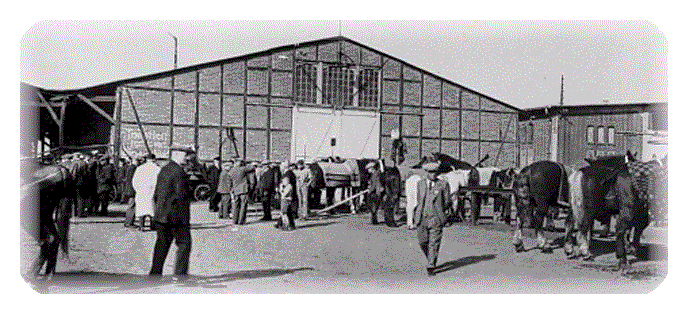
Sonntagvormittag 1935.
Es klingelte 3x kurz. Mein Herz machte einen freudigen Hüpfer: Papa kommt! Mit einem Satz sprang ich vom Kohlenkasten, der neben der Kochmaschine in unserer Küche stand und rannte in den Korridor, um auf den Surrer zu drücken. Ich konnte noch gut rennen, denn ich war erst sechs Jahre alt. Mein Vater kam die fünf Stufen zu unserer Parterrewohnung hoch. Mit einem Blick sah ich, daß er gute Laune hatte. Unterm Arm trug er ein großes Paket, das in hellbraunes Packpapier gewickelt war. Mein Herz machte einen zweiten Hüpfer, denn Pakete fand ich sehr gut. Mein Vater sagte aber: "Dieses Mal ist es nichts für dich, Mäuschen, sondern für mich". Ich war etwas irritiert, blieb aber doch gespannt. Es mußte etwas Schönes sein, das fühlte ich, denn mein Vater schien mir richtig etwas aufgeregt zu sein und so leicht regte er sich nicht auf - er hatte es eher mit der Ruhe.
"Mutti" rief er, "komm doch mal gucken was ich habe" und ging ins Wohnzimmer und legte das Paket auf den Tisch unter die Lampe mit dem großen Seidenschirm, von dem Fransen bammelten. Ich betastete das Paket. Es war etwas Weiches drin. Es mußte aus Stoff sein. Meine Mutter kam aus der Küche und fragte verwundert: "Was ist denn das?", als sie das Paket sah. "Das wurde heute ganz preiswert bei der Versammlung angeboten und da habe ich zugegriffen - denn die Zeit ist ran!"
"Was für eine Zeit ist ran?", wollte meine Mutter wissen.
"Das wirst du gleich sehen" erwiderte mein Vater und knipperte die faserige Strippe auf. Endlich schlug er den großen Bogen Papier auseinander und sagte stolz: "Seht mal!"
Ich sah gleich 3x. Erstens meinen triumphierenden Vater, zweitens meine Mutter, die bald der Schlag zu treffen schien und drittens eine nagelneue SA-Uniform, die mein Vater liebevoll streichelte und voll ausbreitete. Meine Mutter setzte sich erst mal auf einen Stuhl und sagte mit einer so eigenartig verquetschten Stimme: "Bist du von allen guten Geistern verlassen?"
"Wieso", fragte mein Vater verständnislos. Die Freude in seinem Gesicht wich einem enttäuschten Ausdruck. Ich verstand die Welt nicht mehr. Das was vor mir lag, hielt ich wirklich für eine wunderschöne Uniform. Ich strich mit meiner kleinen Hand prüfend über das weiche Tuch. Die Farbe war von einem seltsamen Braun, vielleicht Rotbraun. Ehe ich die erste SA-Uniform gesehen hatte, wußte ich gar nicht, daß es so eine Farbe überhaupt gab. Am besten gefiel mir die rote Armbinde mit dem schneeweißen Kreis, in dem das schwarze Hakenkreuz so richtig leuchtete. Toll würde mein Vater damit aussehen.
Meine Mutter fand das ganz und gar nicht; sie schimpfte los: "Das kommt überhaupt nicht in Frage. Daran hatten wir nie gedacht. Verstehst du nicht, was gespielt wird? Begreifst du überhaupt, was los ist? Gib sofort die Uniform zurück - ich will sie nicht im Haus haben."
"Laß mich doch", preßte mein Vater heraus, "es ist nun mal eine neue Zeit, und wir sind mitten im Umbruch, einem großen Umbruch. Ich kann mich nicht ausschließen." "
Und ob du kannst" fauchte meine Mutter, "geh wieder raus aus dem Verein!"
"Das kommt gar nicht in Frage, die haben uns so geholfen, da kann ich nicht undankbar sein", entschied mein Vater ganz energisch. Ich hielt, wie immer, bedingungslos zu meinem Papa, denn meine Mutter vermießte uns sowieso fast jeden Spaß, fand ich. Sie hatte gegen alles was, was uns Spaß machte. Sie wollte nicht mal mit uns nach Afrika auswandern und auf Safari gehen, um Tiger zu jagen. Sie lachte sogar laut über uns und sagte; wir müßten ganz schön lange durch den Urwald in Afrika rennen, wenn wir da einen Tiger entdecken wollen. Alleine daran sah man doch schon, daß sie von der Jagd keine Ahnung hatte. Sie hatte eine besondere Abneigung gegen die neue Zeit. Ich rief: "Laß Papa doch - er wird prima aussehen!"
"Halt den Mund", herrschte mich meine Mutter böse an. "Was verstehst du Dreikäsehoch schon. Verschwinde!" In ihrem Blick lag ein ganz gefährliches Glitzern, das mich warnte und an Backpfeifen erinnerte. Ich fühlte mich zutiefst beleidigt. Das mir: Ich konnte immerhin schon das kleine Einmaleins mit der Zwei und SA in großen Buchstaben schreiben. Von meinen wundervoll gemalten Hakenkreuzen ganz abgesehen. Ich wußte, was auf der Welt vor sich ging. Mir konnte keiner was vormachen. Ich wußte mehr, als die Erwachsenen ahnten. Ich paßte immer schön auf. Besonders wenn geflüstert wurde. Eines stand jedenfalls fest: Herr Hitler war ein netter Mann! Mir gefiel er und er liebte Schäferhunde - da konnte er doch nicht schlecht sein.
In meiner Ehre getroffen, stolzierte ich davon, während sich meine Eltern weiter zankten. Aus Protest setzte ich mich ans Schlafzimmerfenster. Das hatte mir meine Mutter heute auch schon mal verboten; aber jetzt konnte mir nicht all zuviel passieren. Mein Papa war ja da. Bei ihm durfte ich fast alles. Ich guckte gerne aus dem Fenster, denn drüben auf der großen Wiese hinter Thiemanns Kolonialwarenladen und hinter dem alten Wasserwerk wurden am Sonntagvormittag fremde Männer gebessert. Sie sollten zu guten Volksgenossen erzogen werden. Das konnte ich von unserem Fenster aus gut beobachten und es machte mir Spaß.
Die Männer, die gebessert werden sollten, trugen keine Uniformen - nur die hatten eine an, die was zu sagen hatten. Sie brüllten dann rum und befahlen, was die anderen, die ohne Uniform waren, machen mußten. Zuerst ließen sie sie auf der Wiese ewig rumrennen, bis sie nicht mehr konnten, danach wurde exerziert und danach hieß es: "Auf - nieder- auf - nieder und alle mußten sich xmal in den Dreck schmeißen. Wenn alle ganz zerrupft und mistig aussahen, marschierten sie weg. Ich wußte nicht wohin. Nur die in den Uniformen sahen noch prima aus.
Nun hatte mein Papa auch so eine Uniform. Jetzt hatte er bestimmt auch so viel zu sagen und wenn er brüllte, mußten sich die anderen auf die Wiese werfen und da rumrobben. Da würden meine Freundinnen staunen.
Doch es kam ganz anders. Nach diesem Sonntagvormittag hing die Uniform lange unbeachtet im Kleiderschrank. Aber eines Tages, ich weiß nicht mehr, wann es gewesen ist, zog mein Vater sie endlich an. Ich durfte die Stiefel mit einem wolligweichen Lappen blitzeblank putzen. Richtige Stiefel waren es eigentlich nicht, sondern hohe schwarze Schnürschuhe und um die Waden wurden geformte, auf Glanz polierte Lederteile geschnallt.
An den Außenseiten befanden sich die kleinen Riemchen, die alles zusammenhielten. Ob das nun modern war oder nur billiger, wußte ich nicht. Mein Vater sah jedenfalls großartig aus, richtig stattlich und er bewunderte sich selbst lange und von allen Seiten in dem Spiegel unseres Kleiderschrankes. Es war die erste Uniform, die er trug. Ich platzte fast vor Stolz, so gut gefiel er mir. Meine Mutter war natürlich wieder anderer Meinung und als er sich endlich verabschiedete, sagte sie verächtlich: "Du wirst schon sehen, was du davon hast." Mein Papa grinste nur. Meine Mutter war in absoluter Kaisertreue aufgewachsen. Auch wenn ihr die im Laufe der Zeit abhanden gekommen war, mit der neuen Ideologie wußte sie nichts anzufangen. Eigentlich war sie nur für Gerechtigkeit. Mit Politik hatte sie nichts am Hut, wußte aber genau Bescheid.
Ich weiß es noch, als wäre es heute geschehen. Es wurde dunkel wie an jeden Abend, doch es war kein Abend wie jeder Abend, denn mein Vater kam noch immer nicht zurück. Wir warteten. Eine lange Zeit stand ich mit meiner Mutter in der finsteren Schlafstube am Fenster und sah auf den Triftweg hinaus. Lastwagen fuhren vorbei, mit vielen Männern besetzt, die die gleiche Uniform anhatten, wie mein Vater sie trug. Auf den Köpfen saßen Mützen, die von den heruntergeklappten Sturmriemen festgehalten wurden. Sie sahen so fremd und energisch aus. Mit den Fäusten umklammerten sie brennende Fackeln. Ich wollte wissen was los war, aber meine Mutter wies mich nur zurecht: "Frage mich nicht - ich verstehe es selbst nicht." Das was sie sagte, hatte so eigenartig geklungen, daß ich nicht weiterbohrte. Später setzten wir uns an den warmen Kachelofen. Sie nahm mich auf ihren Schoß und so warteten wir weiter, eng aneinander geschmiegt. Ich spürte, daß sie Angst hatte und da überfiel sie mich auch. Schließlich brachte sie mich aber doch ins Bett und ich versank in den erlösenden Kinderschlaf.
Irgendwann mitten in der Nacht erwachte ich. Mein Vater war zurückgekommen und flüsterte aufgeregt mit meiner Mutter. Manchmal hob mein Vater etwas die Stimme. So aufgeregt hatte ich ihn noch nie erlebt. Einmal klang es wie ein Schluchzen, dann verstand ich ganz deutlich: "Das mache ich nie mehr mit", und meine Mutter entgegnete: "Ich habe es dir ja gleich gesagt, daß nichts Gutes dabei herauskommt. Du hast mir nicht geglaubt - jetzt weißt du es."
Nach dieser Nacht blieb die Uniform wieder lange im Schrank hängen. Mein Vater zog sie nie wieder an. Monate später besuchte uns ein Arbeitskollege meines Vaters, probierte sie an und nahm sie mit. Mein Vater gab große und breite Erklärungen ab: "Du weißt selbst was ich im Betrieb um die Ohren habe. Die Arbeit läßt mir kaum eine freie Stunde. Es gibt für mich keinen Sinn mehr in der SA zu sein und so bin ich wieder ausgetreten. Ich muß ständig für den Betrieb erreichbar sein und mich Tag und Nacht um die Kühlmaschinen kümmern und sie kontrollieren."
Das verstand ich, denn es war wirklich so. An jedem Abend ging er rüber in die Fabrik um nachzusehen ob alles vorschriftsmäßig lief - und ich durfte meistens mit. Im Maschinenhaus roch es oft etwas nach Ammoniak und das kribbelte so ulkig in der Nase.
Eins stand fest: Mein Vater war vom Nationalsozialismus geheilt. Etliche Jahre später wollte ich genau wissen, was sich in jener Nacht zugetragen hatte und fragte meine Eltern. Sie stellten sich beide dumm und konnten sich angeblich an nichts erinnern. Sie verrieten es mir nie; auch nicht als ich erwachsen war. Ich fragte mich manches Mal, wie es soweit kommen konnte, daß wir eine SA-Uniform im Schrank zu hängen hatten und ich spürte der Sache nach.
Die Anfänge der Geschichte lagen etliche Jahre zurück. Seit 1929 arbeitete mein Vater für die Firma Friedrich Krupp als Außenmonteur für landwirtschaftliche Maschinen und als Vorführer neuer Geräte im Raum Sorau. Die Arbeitslosigkeit griff immer weiter um sich. Mein Vater und zwei Arbeitskollegen, alle drei fixe junge Burschen, heckten einen Plan aus, der ihnen auch gelang. Sie befürchteten mit Recht, daß auch sie die Arbeitslosigkeit einholen könnte und so ließen sie sich auf eine Außenstelle von Krupp nach Berlin versetzen, die auf dem großen Magerviehhof in Friedrichsfelde angesiedelt war. Das Glück stand total auf ihrer Seite. Sie mieteten zusammen eine große Baracke, die auch auf dem Magerviehhof stand und ließen Frauen und Kinder nachkommen. Sie befuhren auf ihren Motorrädern die ganze Mark Brandenburg bis hoch zur Ostsee und betreuten große Güter und Bauernhöfe.
Ich war gerade acht Wochen alt, als ich in der Baracke auf dem Magerviehhof in den Armen meiner Mutter Einzug hielt. Am 8.Januar 1932 ging die Rechnung der drei Kumpel voll auf. Die Entlassung von Krupp flatterte ins Haus - aber wir drei Familien waren alle Berliner - und darauf hatten die Männer abgezielt. Sie stellten es sich leichter und Erfolg versprechender vor, in Berlin neue Arbeit zu finden. Leider hatten sich die drei darin mächtig geirrt. Es erwies sich keineswegs leichter in Berlin eine Arbeit zu finden. Die Arbeitslosenunterstützung brachte die Familien in echte Not; sie war sehr karg bemessen. Mein Vater hatte Glück. Seine Schwester Anna betrieb mit ihrem Mann in Dahme in der Mark ein gutes Geschäft mit dem Handel und der Reparatur von Landmaschinen. Dort konnte sich mein Vater durch Aushilfsarbeiten etliche Märker dazuverdienen und seine Familie über Wasser halten. Doch es blieb nur eine Hilfe. Er strampelte nach allen Seiten, versuchte es mit List und Tücke - neue Arbeit fand er nicht.
Im Frühsommer, der folgte, lernte mein Vater bei einem Familienausflug, den er mit meiner Mutter und mir machte, einen Mann kennen. Sie tranken ein Bierchen zusammen und kamen ins Gespräch, wie das so ist. Mein Vater erzählte von seiner Arbeitslosigkeit. Da sagte der fremde Mann: "Mensch - sei doch nicht blöde! Du mußt in den Stahlhelm eintreten. Die sorgen für ihre Leute. In kurzer Zeit kriegst du Arbeit!" Mein Vater zauderte nicht lange, denn das Wasser stand ihm bis zum Hals. Er wollte es versuchen, nahm Kontakt auf und trat in den Stahlhelm ein.
Der Stahlhelm war eine Organisation in der sich Frontkämpfer des Weltkrieges 1914-1918 zusammengeschlossen hatten. Mein Vater, Jahrgang 1903, paßte eigentlich nicht hinein in diesen Verein, er war nie Soldat gewesen, aber man sah das alles nicht so eng und empfing ihn mit offenen Armen. Er selbst verspürte auch nicht die geringsten Bedenken. Damals liebte Deutschland noch seine Helden, im Gegensatz zu heute. Als Junge hatte er die Burschen in seinem Heimatdorf beneidet, wenn sie als flotte Soldaten in schmucken Uniformen auf Urlaub kamen. Neidisch hörte er zu, wenn sie von ihren Heldentaten erzählten. Ja, so war das damals - er wäre so gern ein Held gewesen. Nun gehörte er wenigstens irgendwie zu ihnen, er war Mitglied in ihrem Verein.
Nur 14 Tage später, am 31.Mai 1932, mein Vater arbeitete gerade wieder zwei Tage in Dahme, hörte meine Mutter, wie ein Krad vorfuhr. Gleich darauf klopfte jemand an unsere Tür. Es war schon nach 22 Uhr, und meine Mutter öffnete die Tür mit gemischten Gefühlen, denn sie befürchtete um diese Zeit etwas Unangenehmes. Es war ein netter junger Mann vom Stahlhelm und er rief ihr zu: "Morgen früh um 6.00 kann ihr Mann als Goliathfahrer anfangen zu arbeiten und zwar in der Fleischwarenfabrik Sedina im Triftweg!"
Vollkommen aufgeregt lief meine Mutter im Dunkeln zu einer Telefonzelle und benachrichtigte meinen Vater in Dahme. Der zauderte nicht lange, schwang sich auf sein Motorrad und fuhr sofort und im strömenden Regen nach Hause. Pünktlich früh um 6.00 Uhr trat er seine neue Arbeitsstelle an und blieb 20 Jahre. Es gelang ihm, seine beiden alten Kumpel nachzuholen, die auf dem Magerviehhof zurückgeblieben waren. In ganz kurzer Zeit stieg er auf zum Maschinenmeister.
Doch wieder ein Stück zurück. 1933 übernahmen die Nationalsozialisten den Stahlhelm und gliederten ihn in ihre SA ein. Mein Vater war plötzlich ein SA-Mann und einige Zeit später hing die Uniform in unserem Kleiderschrank.
Anhängsel für "Die Uniform"
Als ich drei Jahre alt war, verließen wir den Magerviehhof und zogen nach Alt-Friedrichsfelde. Dort, wo die 69 Ecke Schloßstraße, von Karlshorst kommend, um die Ecke quietschte, um zum Bahnhof Lichtenberg zu fahren, fängt die Rhinstraße an. Gleich links in einem kleinen flachen, etwas langgestrecktem Häuschen, es steht heute noch, aber wer weiß wie lange, wohnten wir ein halbes Jahr beim ollen Adomat. Vielleicht hieß er auch Adomeit, aber alle nannten ihn nur den ollen Adomat. Wahrscheinlich, weil er immer etwas vermeckert war. Weil mein Vater sich total für seine Arbeit engagierte, zogen wir in die gleich neben der Fleischwarenfabrik liegende Wohnung der Kriegerheimsiedlung Triftweg 67. Heute Splanemannsiedlung Ontarioseestr. 14.