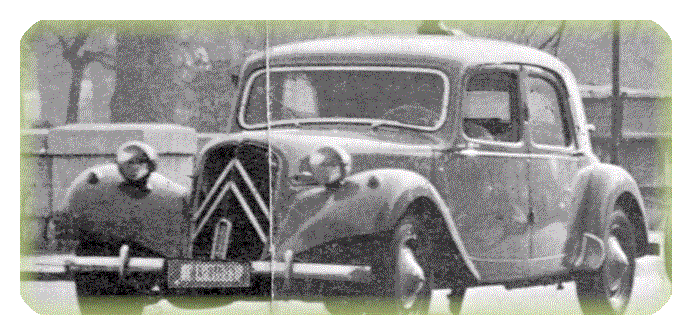
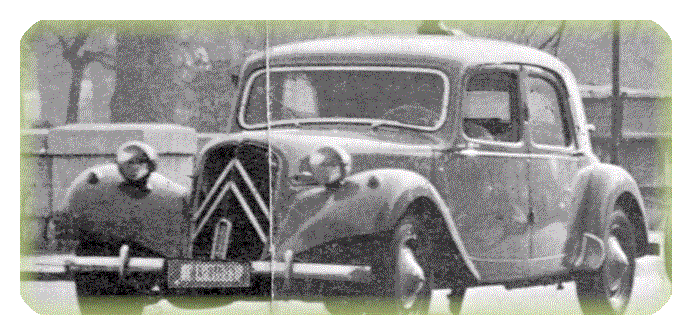
Immer, wenn ich Gulasch koche, fällt mir unser ehemaliges Auto ein. Genauer gesagt: das Auto meiner Eltern. Warum mir das gerade beim Gulaschkochen passiert, werden Sie gleich erfahren
Unser Auto - mein Gott - war das ein Wagen. Ein Traumauto, sogar in mehrfachem Sinne. Warum? Sie werden auch das erfahren.
Es war ein Citroen, Baujahr etwa 1937, in Tiefdunkelblau. Der Lack glänzte und schimmerte wie kostbare Seide. Die grauen, weichen Polster sahen etwas gesprenkelt aus - etwa wie Pfeffer und Salz. Die Karosse lag verhältnismäßig tief für damalige Autos. Wenn der Motor auf Touren kam, klang das wie liebliche Musik in unseren Ohren.
Bevor wir diese Prunkkalesche in unseren Besitz nahmen, waren meine Eltern leidenschaftliche Motorradfans. Auf einer BMW knatterten sie durch die deutschen Lande, hauptsächlich durch die Mark Brandenburg. Beide steckten dann in imprägnierten Kombinationen, die wie aus Zeltleinen gemacht aussahen und auch so eine grünlich-graue Farbe hatten. Auf der Nase trugen sie große Brillen aus Zelluloid, die die Augen vor dem Fahrtwind schützten, und den Kopf umschlossen enganliegende Kappen, damit kein einziges Haar flattern konnte. Mein Vater fuhr, und meine Mutter huckte hinter ihm auf dem Sozius. Nicht einmal, als sie mit mir schwanger war, verzichtete sie auf das Vergnügen ihrer Motorradfahrten. So wurde mir der Klang einer BMW schon vertraut, ehe ich Muttermilch zu kosten bekam. Noch heute, nach fast 65 Jahren, hüpft mein Herz, wenn ich das Blubbern einer schweren Maschine höre, und ich recke meinen Hals nach ihr aus.
Als ich im Hochsommer 1929 greifbar auf der Welt in den Windeln lag, vervollständigten meine Eltern das Motorrad durch einen Beiwagen. Der war vorne etwas länglich, so daß meine Mutter ihre Beine leicht gespreizt ausstrecken konnte, und dazwischen verbrachte ich die ersten neun Jahre meines Lebens. Nicht ausschließlich, aber an fast jedem schönen Wochenende, das Gott werden ließ, saß ich da geborgen zwischen den Beinen meiner Mutter. Nun ergab es sich, daß meine eigenen Beine mit der Zeit wuchsen und wuchsen und logischerweise immer länger wurden. Bald erreichte ich mit den Füßen die Spitze des Beiwagens, und meine Mutter protestierte, wenn ich mich dagegenstemmte.
Wenn das Wetter es zuließ, ging es also übers Land ins Grüne. Wir fuhren an die funkelnden Seen rund um Berlin, in die Kiefernwälder der Umgebung und in die großen, gemütlichen Ausflugslokale, in denen Familien für ein paar Pfennige als Entgeld noch selber Kaffee kochen konnten.
Das ging so, bis wir eines schönen Sonntags auf der Heimfahrt vom Schlaubetal fürchterlich einregneten und uns alle drei schrecklich erkälteten. Da verlor meine Mutter gründlich und nachhaltig den Geschmack und den Spaß an diesen Fahrten. Sie schimpfte, jetzt habe sie die Faxen dicke, und es sei endgültig genug. Als das Gemecker kein Ende nahm, verkündete mein gutmütiger Vater: "Gut - überredet. Wir kaufen ein Auto! Natürlich ein gebrauchtes!".
Mein Vater war Maschinenmeister in der Sedina Fleischwarenfabrik Emil Krüger. Die lag im Triftweg, der später in Hans-Loch-Straße und danach in Ontarioseestraße umgetauft wurde. Nach der Wende ging die Fabrik in den Besitz der Firma Wache über, Ende 1996 riss man sie ab. Wir wohnten gleich nebenan im ersten Haus der Kriegerheimsiedlung , rechts unten im Hochparterre. Jetzt heißt sie Splanemannsiedlung - die erste Siedlung in Deutschland, die in Plattenbauweise gebaut wurde - und steht unter Denkmalschutz.
Vater besaß die außerordentliche Begabung, jeden Motor zum Laufen zu bringen, auch wenn er noch so schrottreif schien. So lag es nahe, daß er jede notwendige Reparatur, die an einem eigenen Auto eventuell notwendig werden sollte, selbst ausführen konnte. Das erleichterte den Besitz wesentlich. Außerdem verdiente er gutes Geld, und so stand dem Kauf eines gebrauchten Wagens nichts im Wege. Aber von wem ein Auto kaufen, das gut und billig war? Durch Zufall, ich weiß nicht durch welchen, hörte er von einer jüdischen Familie, die ihr Auto verkaufen mußte. Ich betone ausdrücklich das Wort "mußte". Mein Vater nahm Verbindung zu den Leuten auf.
Wir schrieben damals das Jahr 1938. Das Leben der Juden in Berlin wurde immer schwieriger. Alle Bedrohungen und Drangsalierungen, denen sie ausgesetzt wurden, kann ich hier nicht schildern. Ihre Geschäfte hatte man größtenteils schon geschlossen und enteignet und für ihr Auto ein Fahrverbot ausgesprochen. Ab dem 3.Dezember 1938 zog man ihre Führerscheine offiziell ein. Die Juden wurden entrechtet, entmachtet und zum Freiwild erklärt.
Ich mit meinen 9 Jahren stand vor einem Rätsel. Ja, ich stellte mich, was die Juden betraf, geradezu begriffsstutzig an, denn die Juden, die ich kannte, waren nette Leute, waren Menschen wie wir. Was war plötzlich los? Ich besuchte das dritte Jahr die Römerschule in Karlshorst. Unser Klassenlehrer war der nette Herr Ide, später wurde es der von mir besonders geliebte Rektor Paul Loeper. Keiner von beiden traktierte uns so übermäßig mit Politik, daß es in Hetzerei ausartete. Noch heute sei ihnen Dank dafür.
Ich fiel aus allen Wolken und hörte verblüfft zu, als sich meine Eltern wegen des Autos, das wir noch nicht einmal besaßen, ernsthaft in die Haare gerieten. Meine Mutter rief erbost: "Das können wir doch nicht machen! Wir können ihnen doch nicht auch noch das Auto wegnehmen!". Und mein Vater schrie zurück: "Und ob wir das können! Wir nehmen es ihnen nicht weg - wir kaufen es ihnen ab. Der Preis ist gerechtfertigt und sie brauchen das Geld dringend. Vielleicht können sie noch rechtzeitig abhauen.".
Mir erschien alles immer rätselhafter. Wohin haute man ab - und warum? Ich fragte meine Eltern. Mutter fauchte sofort zurück: "Halte den Mund, das geht dich nichts an!". Diesen Spruch hörte ich jetzt immer öfter.
Etwas wurde mir jedenfalls klar: Zwischen abhauen und abholen schien es einen geheimnis- unheilvollen Zusammenhang zu geben, den ich noch nicht in allen Einzelheiten verstand.
Eines Tages im Winter 1938 war es soweit. Mein Vater fuhr in den vornehmen Westen Berlins, um das Auto, einen Citroen, abzuholen, und ich durfte mit. Dieses große Ereignis stimmte mich froh und erwartungsvoll. Leider weiß ich weder den Namen noch die Adresse der jüdischen Familie, darum will ich sie hier Familie S. nennen. Sie wohnte irgendwo in der Innenstadt in einer ruhigen und vornehmen Straße. Verwundert betrachtete ich das prunkvolle Treppenhaus mit den Spiegeln, den Teppichen, dem geschnitzten Geländer und dem Fahrstuhl. Familie S. bewohnte eine große, hohe, sehr elegante Wohnung; eine ähnliche hatte ich noch nie gesehen. Alles war anders in unserer kleinen Zweieinhalbzimmerwohnung. An einem Klavier saß ein Junge, ungefähr so alt wie ich.
Er spielte eine wundervolle Melodie - nicht etwa "Hänschen klein". Daß ein Kind in meinem Alter so etwas konnte, versetzte mich in Erstaunen. Er hörte auf zu spielen und sah mich aus großen ernsten Augen prüfend an; aber weiter kümmerte er sich nicht um mich. Meine fröhliche Stimmung verflüchtigte sich. Eine eigenartige Atmosphäre lag über der Wohnung - und über den Menschen. War ich in einem Trauerhaus? Auf keinem Gesicht erschien ein Lächeln. Frau S. hatte uns mit ernstem Ausdruck empfangen und schien wie erstarrt. Sie war eine große, schlanke schöne Frau wie aus einer Illustrierten. Ihre fast schwarzen Locken trug sie hochgesteckt, und ihre Augen waren die gleichen wie die des Jungen. Sie wirkte so ganz anders als meine kleine, mollige Mutter. Alles war anders. Familie S. schien das zu sein, was meine Mutter meinte, wenn sie von "besseren Leuten" sprach.
Man bat uns, Platz zu nehmen. Es wurde immer beklemmender. Dann entschuldigte sich Frau S., weil ihr Mann noch nicht da war. Sie bat uns, wir mögen uns doch bitte noch einen Moment gedulden, ihr Mann wäre noch einmal in die Garage gegangen, um von seinem Auto Abschied zu nehmen. Er hänge so an ihm, es sei sein ganzer Stolz gewesen. Mit dem Auto hatte er sich einen Traum erfüllt, und es schmerze ihn entsetzlich, es hergeben zu müssen. Er setze sich, seit er nicht mehr fahren dürfe, oft hinein und träume von vergangenen, besseren Tagen. Aber er wisse natürlich, daß er es hergeben müsse - das sei ganz klar, und uns persönlich mache sie auch keinen Vorwurf. Die Stimme von Frau S. klang tränenerstickt und zitterte etwas.
Plötzlich wollte ich das Auto gar nicht mehr. In mir war jede Freude abgestorben. Aber dann ging alles sehr schnell. Herr S. - ein leichenblasser, todtrauriger, großer Mann - kam aus der Garage und tauschte mit meinem Vater die Autopapiere und die Wagenschlüssel gegen Geld, und dann gingen wir mit ihm hinunter in die Garage. Herr S. fragte seine Frau noch, ob sie mitkommen wolle, aber sie sagte nur: "Ich kann nicht" und blieb mit dem Jungen oben.
Und dann sah ich unser neues Auto das erste Mal, und mein Herzchen hüpfte wieder. Unser Auto! Wir verabschiedeten uns von Herrn S. und stiegen ein. Als wir losfuhren, sah ich durch die Heckscheibe und winkte ihm vergnügt. Er nahm mich überhaupt nicht wahr. Mit hängenden Schultern und starrem Gesicht sah er uns reglos nach ohne zurückzuwinken. Ich verstand nichts.
All der verdammt schweren Zeit zum Trotz - für uns brach eine schöne Zeit an. Endlich konnten wir auch im Winter Ausflüge machen. Oft fuhren wir zu meiner Großmutter nach Forst oder zu einer Tante nach Dahme oder einfach sonst wohin. An schönen Sommertagen erlaubten meine Eltern, daß eine meiner Freundinnen mich begleitete, und dann wurde es ein doppeltes Vergnügen.
Auf der anderen Straßenseite, schräg gegenüber von unserer Wohnung, stand ein kleines Holzhaus - mehr eine Bude. Darin führten Thiemanns, die ebenfalls bei uns in der Siedlung wohnten, einen bescheidenen Kaufmannsladen. Hinten an der Bude klebte ein Bretterschuppen, der leer stand, und den mieteten wir als Garage.
Ich platzte fast vor Stolz, wenn unser herrliches Auto vor der Tür stand, und ich beobachtete genau, ob unsere Nachbarn auch gebührend Notiz nahmen. Ich konnte beruhigt sein: sie nahmen. Es gab nicht viele Autos in der Kriegerheimsiedlung - vielleicht zwei oder drei. Wenn wir durch Karlshorst die Treskowallee entlangfuhren, hielt ich mein kleines Gesicht ganz dicht an die Scheiben, damit jedes Mädchen aus meiner Klasse, das mich zufällig sah, dachte: "Ah - da fährt die Rosie in ihrem schönen Auto.". Manchmal träumte ich und spielte, ich wäre eine Prinzessin.
Frau S. kam uns öfter kurz besuchen. Sie kam immer allein. Ich mußte nach der Begrüßung in meinem Zimmer verschwinden. Natürlich versuchte ich, so viel aufzuschnappen wie nur möglich. Meistens weinte Frau S. Ehe sie wieder ging, packte meine Mutter in der Küche geheimnisvolle Päckchen. Als ich einmal unverhofft die Küche betrat, packte sie gerade Brot ein. An vieles hatte ich gedacht, aber an Brot nicht. Brot? Warum Brot? Das gab es doch überall auf Marken zu kaufen.
An einem Sommertag schluchzte Frau S. schon im Korridor, und ich hörte alles. Sie sagte, es werde immer schlimmer. Neulich hätten sie einen Ausflug an den Müggelsee gemacht, um sich abzulenken. Es sei glühend heiß geworden, aber man hätte ihnen am Kiosk nicht einmal ein Glas Wasser für ihren Jungen gegeben.
An einem anderen Tag klingelte Frau S. wieder. Sie klingelte immer nur einmal ganz kurz und kein zweites Mal; das war zu ihrem und unserem Schutz so verabredet. Wir konnten nicht öffnen, den Herr Fersenheim aus unserem Haus war gerade bei uns. Der war in der NSDAP und wollte für den Eintopfsonntag kassieren und versuchte immer, uns den Schulungsbrief anzudrehen. Meine Mutter machte nicht auf und sagte, das wären bestimmt wieder die Gören, die hätten heute schon mal einen Klingelstreich gemacht. Frau S. klingelte nicht mehr. Sie klingelte nie wieder. Sie kam nicht mehr. Meine Eltern flüsterten besorgt. Eines Tages packte meine Mutter wieder Päckchen, mein Vater fuhr zur Familie S. und kam ratlos zurück. Keiner hatte geöffnet, und in der Wohnung war alles totenstill. Er versuchte es noch einmal, aber auch dieses Mal umsonst. Wir hörten nie wieder etwas von der Familie S. Ob sie es geschafft haben?
Im Sommer 1939 verbrachten wir drei herrliche Ferienwochen an der Ostsee. Wir nahmen Privatquartier in einem strohgedeckten Haus in dem Dorf Funkenhagen und fuhren auch nach Kolberg, um die großen Schiffe anzusehen. Natürlich mit unserem wundervollen Auto. Wir ahnten nicht, daß es unsere einzige Reise mit dem Citroen bleiben sollte.
Der Zweite Weltkrieg brach aus! Im Gegensatz zu anderen Privatwagen wurde unser Auto nicht beschlagnahmt, weil es ein "Franzose" war. Im Falle einer nötigen Reparatur hätte man bei der deutschen Wehrmacht keine Ersatzteile beschaffen können. Nun durften wir zwar das Auto behalten, aber man nahm uns alle Reifen weg. Und so stand unser schönes, wertvolles Auto während der ganzen Kriegsjahre hochgebockt in Thiemanns armseligen Schuppen und sah ganz, ganz langsam weniger strahlend aus. Sein Glanz wurde stumpf, und im Laufe der Zeit rochen die Polster immer muffiger. Auch wenn wir ab und zu den Lack wienerten, bildeten sich kleine Roststellen wie Wunden. Wie damals Herr S. saßen mein Vater und ich jetzt öfter wehmütig im Fond, schuckelten leise vor uns hin und träumten von vergangenen, schöneren Zeiten. Wieder und wieder kramte ich dann in allen Klappen und Taschen herum, um vielleicht etwas zu finden - etwas aus diesen vergangenen, unvergeßlichen Zeiten. Und eines Tages fand ich wirklich eine Tafel Schokolade. Ich war reinweg außer mir vor Freude. Bestimmt hatte mein Vater sie eingeschmuggelt. - Dann vergaßen wir unser Auto.
1945, Ende April, kamen die Russen. Der Krieg war aus. Die Fleischfabrik, die für die Wehrmacht gearbeitet hatte, war vollgeknallt mit Fleisch bis unters Dach. Ein russischer Kapitän übernahm sie, und die Bewirtschaftung ging nahtlos weiter, ohne einen Tag zu stoppen. Einen Teil der Vorräte verteilte man unter der Bevölkerung. Mein Vater - als einziger Fachmann - arbeitete Tag und Nacht, um die Kühlung aufrechtzuerhalten. Er aß mit den Russen ihr Brot und ihren Speck und mußte dazu den Wodka aus Wassergläsern trinken. Es war eine wilde Zeit. Bei so einer Gelegenheit erinnerte sich Vater plötzlich an seinen Citroen. Der Kapitän glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. Ein Citroen? Ein Franzose? So ein Auto war doch schon immer der Traum seines Lebens gewesen. Eine ganze Abordnung neugieriger Russen, an der Spitze der Kapitän, zog rüber zu Thiemanns Schuppen. Und da stand der Traum des Kapitäns, hochgebockt und ohne Reifen. Die Augen des Russen strahlten. Er schlug meinem Vater auf die Schultern und brüllte: "Karascho! Nix Reifen? Ich organisieren! Du dann fahren! Ich großer Kapitän! ".
So geschah es. In zwei Tagen konnte mein Vater Räder anmontieren und das Auto in der Fabrik fahrtüchtig herrichten. Als ich es das erste Mal wieder sah, konnte ich es nur erstaunt betrachten. Das sollte unser schönes Auto sein? Es ließ mich kalt - der Traum war ausgeträumt.
Jetzt war der Citroen der Traum des russischen Kapitäns. Stolz lächelnd ließ er sich von meinem Vater durch Karlshorst kutschieren. Er fuhr zu allen Kommandanturen und zu seinen Kameraden, die sich in den Villen einquartiert hatten. Alle sollten ihn bewundern, alle sollten sehen, daß er etwas Besonderes darstellte. Ein russischer Kapitän in einem Citroen war in Berlin bestimmt einmalig.
Eine Privatfahrt für meinen Vater, womöglich noch mit meiner Mutter und mir, kam in keinem Fall in Betracht. Erstens hatten wir kein Benzin und zweitens würden uns andere Russen das Auto unter dem Hintern wegklauen. Mein Vater fuhr ausschließlich für Russen und mit Russen. Die Russen konnten alles gebrauchen und nahmen sich auch, was sie wollten. Ihre Hauptbeschäftigung wurde es, mit meinem Vater requirieren zu fahren. Den Ost- und den Westhafen liebten sie besonders. Vater mußte im Auto warten, während sie die Lagerhallen durchforsteten und mit ihrer Beute das Auto voll knallten, bis nichts mehr rein ging. Mit Karascho und Karacho sausten sie durch ganz Berlin. Wieder in der Fabrik, wurde geteilt. Jeder Russe bekam seinen Anteil und mein Vater ebenfalls. Einmal befand sich unter dem Plündergut ein Sack ganz kleiner, aber höllisch scharfer getrockneter Paprikaschoten. Der Anteil meines Vaters davon fiel großzügiger aus als sonst; er war so reichlich bemessen, daß nach dem Tode meiner Eltern ein Rest als Erbe bei mir in der Küche gelandet ist. Noch heute - nach fünfzig Jahren - würze ich mein Gulasch mit diesen Paprikaschoten, und deswegen fällt mir immer unser Auto ein, wenn ich Gulasch koche.
Als man den Kapitän abkommandierte, mußte er blutenden Herzens sein Traumauto zurücklassen. Wehmütig und liebevoll strich er mit seiner schweren Hand über die Kotflügel. Ein letztes Mal setzte er sich hinein und träumte von schönen vergangenen Tagen. Wenigstens eine Zeitlang hatte er dieses herrliche Auto besessen und er war ein beneideter Kapitän in Karlshorst gewesen.
Unser Auto gehörte uns wieder. Die Reifen hatte der Kapitän meinem Vater zum Abschied geschenkt. Wir hatten jedoch kein Benzin und konnten so nichts mit ihm anfangen. Da es sich unter den Russen herumgesprochen haben mußte, daß wir einen Citroen besaßen, wurde Vater beauftragt, für die Karlshorster und die Friedrichsfelder Kommandantur zu fahren - hauptsächlich in den späten Abendstunden. Die Russen kontrollierten die Tanzlokale, die plötzlich wie Pilze aus der Erde schossen. Traf man zu junge Mädchen an, schickte man sie nach Hause. Traf man Russen an, nahm man sie mit, denn denen war der Aufenthalt in Tanzlokalen verboten. Diese Kontrollfahrten veranstalteten Russen und Deutsche schon gemeinsam. Nach einem Jahr ungefähr hörten sie auf.
Wir wußten nicht, was wir mit dem Auto anfangen sollten. Das Benzin auf dem Schwarzen Markt kostete unerschwinglich viel Geld, und das hatten wir nicht. Der Schuppen bei Thiemanns fiel auch ein. Die Schieberzeit stand in der Hochblüte, und so fand sich endlich einer, der sich auf diesem Gebiet auskannte, dem das Geld locker saß und der sich seinen Traum vom eigenen Auto erfüllen wollte. Er kaufte es. Nun gehörte das schöne Auto des Juden S. einem Schieber, und war dessen Traum. Für uns verlor sich seine Spur.
Gerade jetzt eben habe ich beschlossen, die kleine Büchse mit dem Rest der requirierten Paprikaschoten zu retten. Sie sollen nicht mehr im Gulasch verkocht werden. Ich stelle sie unter Denkmalschutz und gebe ihnen einen Platz in der Vitrine im Wohnzimmer.