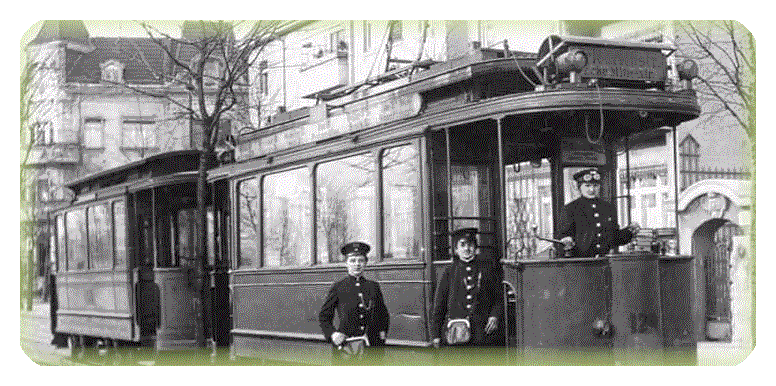
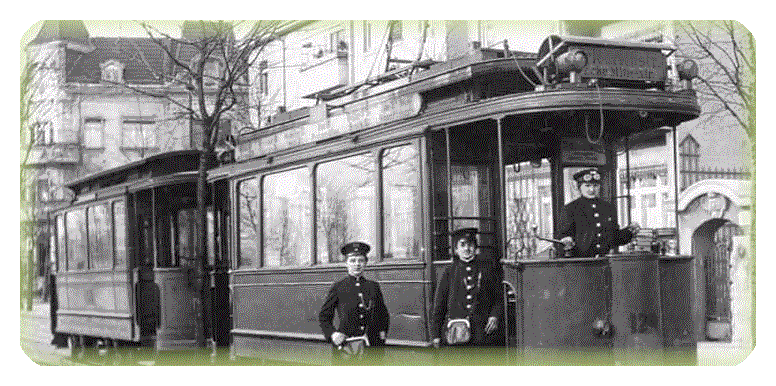
Die Straßenbahnlinie 69 ist in meinen Kindheits- und Jugenderinnerungen fest verankert. Sie fuhr mich in die große Welt, als ich noch klein war. Wohin man von unserer Kriegerheim-Siedlung aus auch wollte - zuerst mußte man mit der 69 fahren, um an andere Verkehrsverbindungen heranzukommen. Es war ganz egal, ob man nach Amerika oder nach Posemuckel wollte; ohne die 69 ging es nicht. Ihre Strecke war einmal die längste, die durch Berlin fuhr. Sie reichte von Johannisthal bis zum Südwestkorso. Unvergeßlich ist mir, wie sie in Friedrichsfelde, Ecke Schloßstraße, um die Ecke quietschte. Sie verband uns auf bequemste Weise mit der Innenstadt. Wir tuckerten oder flitzten die Frankfurter Allee hoch bis zum Alexanderplatz, an der berühmten Berolina vorbei, über den Spittelmarkt und über die Seestraße hinaus bis an das andere Ende Berlins - ohne einmal umsteigen zu müssen. Herrlich war das.
Ursprünglich fuhr sie die ganze lange Frankfurter Allee hoch - bog ein zum Küstriner Platz, an dem die berühmte Plaza stand, fuhr weiter über den Spittelmarkt, Potsdamer Platz, Nollendorfplatz, Winterfeldplatz, Bayerischer Platz, Kaiserplatz - bis nach Friedenau. Als die Frankfurter Allee durch den Straßenkampf der letzten Kriegstage fast vollkommen in Trümmern lag, fuhr sie die Siegfriedstraße entlang, über den Bahnhof Landsberger Allee hinaus. Notgedrungen mußte sie mehrmals ihre Streckenführung ändern.
Jeder Besuch, der zu uns kam, kam mit der 69 angefahren. Ich stand dann an der Haltestelle Triftweg und erwartete ihn. Auf unserer Seite war ein Akazienwäldchen und ein Riesenholzkasten mit Streusand für den Winter. Auf dem hockte ich oft und erwartete unsere Gäste. Drüben, Richtung Friedrichsfelde, befand sich Müllers schönes Gartenrestaurant. Da schleckte man vor dem Krieg das beste Vanilleeis, das es je irgendwo gab. Heute befindet sich da, nur weiter zurückgesetzt, das Verwaltungsgebäude des Tierparks. Rundherum war alles grün bewaldet.
Ich fand es aufregend, mit der 69 zu fahren. Besonders im Sommer, weil die Perrons vorne und hinten sehr offen und luftig waren. Am Einstieg gab es keine Tür, und eine Wand konnte zum offenen Fenster umgestaltet werden. Das war bei schönem Wetter eine angenehme Sache, die Kindernase direkt in den Wind zu halten. Je doller, je besser.
Es gab mehr Begleitpersonal als heute. Vorne stand der Fahrer, und ein Schaffner lief hin und her und rief dauernd: "Noch jemand ohne Fahrschein, bitte?". Er bemühte sich zu jedem einzelnen Fahrgast hin und kassierte. War die Bahn an einer Haltestelle angelangt, flitzte er an die Eingangsstufen vorne oder hinten, beobachtete den Ablauf des Ein- und Aussteigens, rief ab und zu: "Beeilung bitte - zurückbleiben!", und dann zog er energisch an einem Lederband in der Höhe eines ausgestreckten Armes, das führte nach vorne zum Fahrer und ließ eine Klingel bimmeln. Daraufhin wußte der Fahrer, daß es weitergehen konnte und fuhr los. Im Anhänger war ein zweiter Schaffner, der auch kassieren und abbimmeln mußte. Auf dessen Signal mußte der Fahrer natürlich noch achten.
Die Schaffner hatten eine Geldtasche umgehangen, in die alle Scheine kamen, und eine kleine Maschine mit mehreren röhrenartigen kleinen Abteilungen. In diese füllten sie von oben das Hartgeld. Mußte der Schaffner drei Groschen herausgeben, drückte er am Groschenabteil dreimal auf einen kleinen Hebel, dann machte es dreimal klick, und unten fielen die Groschen heraus.
Jeder Fahrschein wurde von einem kleinen Block abgerissen. Die Überbleibsel der Blöcke wurden von uns Kindern heiß begehrt. Wir bemalten jedes einzelne Blättchen mit Strichmännchen in laufenden Bewegungen, und wenn man sie mit dem Daumen abgleiten ließ, sah es aus, als bewegten sich die Bilder wie im Kino. Manche Kinder konnten das fabelhaft. Ich war keine große Leuchte, aber ich übte wie besessen. Manches Mal stand ich stundenlang an der Haltestelle Triftweg, wartete von einer 69 auf die andere und rief dann laut: "Herr Schaffner, ham’se ‘nen Block?": Bekam ich endlich einen zugeworfen, trabte ich glücklich nach Hause und machte neuerliche künstlerische Versuche..
Eine Schulfreundin meiner Mutter, Lieschen Menzel, war im Ersten Weltkrieg Straßenbahnschaffnerin gewesen, und ihr gehörte jahrelang meine vollste Bewunderung. Ich überlegte ernsthaft, ob dieser Beruf nicht auch für mich der richtige wäre, wenn ich mal groß sein würde.
Sehr gerne stand ich auch im Triebwagen neben dem Fahrer. Am allerliebsten vorne in der schmalen Nische neben seinem Fahrpult mit der großen Kurbel. Da durfte ich nur stehen, wenn er sehr gute Laune hatte. Manchmal, an einer Kreuzung, scheuchte er mich weg, trat selber in die Nische, schob ein Fenster auf und lehnte sich hinaus, um mit Hilfe einer Eisenstange eine Weiche zu stellen - dann durfte ich wieder in die Ecke. Und wenn er ganz, ganz besonders gut gelaunt war, erlaubte er mir, auf die Warnbimmel zu treten - die war im Boden zu seinen Füßen eingelassen. Man konnte ganz schnell hintereinander rauftreten, das machte den meisten Spaß. Wir ratterten dann auf den Schienen entlang, und es machte laut "Kling, Kling, Kling". Das signalisierte den anderen Verkehrsteilnehmern: Macht die Schienen frei - wir kommen angesaust.
Der Fahrer, der arme Kerl, muß im Winter ganz schrecklich gefroren haben. Er steckte dann zwar in einem schweren Lammfellmantel, seine Füße in riesigen Filzstiefeln, und den Kopf schützte eine mächtige warme Mütze mit Ohrenklappen. Aber immer stand er neben dem offenen Einstieg. Türen gab es erst sehr viel später. Ich glaube, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch das Innere der Wagen, in dem sich die Sitzplätze befanden, war vorne und hinten nur durch einen dicken Filzvorhang abgeteilt. Der war bei großer Kälte vollkommen vereist, und die Fensterscheiben bedeckte eine dicke, verkrustete Eisschicht - trotz der Heizung, die es gab. Ich hielt oft einen warmen Finger an das Eis und taute ein Löchlein hinein, um sehen zu können, durch welche Gegend wir fuhren und wann es Zeit war, auszusteigen.
Vor dem Krieg fuhr meine Mutter regelmäßig freitags auf den Wochenmarkt nach Karlshorst. Ich durfte mit. Eines Tages trafen wir dort eine Nachbarin aus unserem Haus mit ihrer kleinen Tochter im Kinderwagen. Auf der Nachhausefahrt sahen wir sie beim Einsteigen schon innen am Fenster sitzen. Da plötzlich ein lauter Aufschrei: "Haach - ich muß raus - ich hab ja mein Kind vergessen!". Ganz aufgeregt und durcheinander kam sie schnellstens wieder rausgekrabbelt und rannte zurück auf den Markt. Die 69 fuhr mit vielen lachenden Fahrgästen davon.
Ich erinnere mich an zwei schwere Unfälle der 69, die an unserer Eisenbahnbrücke am Triftweg geschahen und beide gute Bekannte von uns betrafen. Eine junge Frau wurde regelrecht geköpft und einem Kollegen meines Vaters ein Bein abgefahren. An das, was auf ihrer langen Strecke sonst noch alles passierte, wage ich überhaupt nicht zu denken.
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ich war nun zehn Jahre alt, wurden wegen der verordneten Verdunkelung alle Fenster mit schwarzer Farbe bestrichen und an jedem nur ein ganz schmaler Sehschlitz freigelassen, damit man wenigstens etwas Tageslicht hatte. Da die Glühbirnen innen auch nur wie Funzeln glimmten, glichen die Straßenbahnen den Geisterbahnen auf dem Rummel. Auch unsere Linie 69.
Ende August 1942 betrachtete ich die 69 plötzlich mit staunenden Augen. Und das kam so: Am 28.August bombardierten unsere Feinde Berlin, und auf den Bezirk Lichtenberg fielen die ersten Bomben, die größeren Schaden anrichteten. Sie trafen ausgerechnet den Giebel unseres Hauses Triftweg 67 und die Erste Stettiner Fleischwarenfabrik Emil Krüger neben uns. Gleich am ersten Tag danach mußte der Triftweg vorne an der Treskowallee gesperrt werden. Die Polizei riegelte alles ab. Tausende von Menschen aus ganz Berlin strömten herbei, um sich anzusehen, wie es in natura aussieht, wenn Bomben fallen. Und die gute 69 karrte sie von weither heran. Die Waggons konnten die Leute nicht fassen. Sie standen und hingen außen dran, wo es eine Möglichkeit zum Festhalten gab. Wie Trauben bammelten sie an den Einstiegen. Es war ein unbeschreiblicher Anblick. So hatte ich die 69 noch nie gesehen.
Die schlimmste Phase des Krieges stellte alles auf den Kopf, aber die 69 fuhr unbeirrt ihren Weg. Fast über Nacht wurden Bombenschäden an Gleisen und Oberleitungen von Zwangsarbeitern oder Pioniertruppen der Wehrmacht repariert.
Szenenwechsel! Es war Mitte Februar 1945. Ich war 15 Jahre alt. Die Russen standen schon einige Zeit an der Neiße. Die Osthälfte von Forst war von ihnen besetzt. Es gab kaum noch Zivilisten in der Stadt. Alle befanden sich auf der Flucht; aber dreimal unternahmen meine Schwester Evchen und ich noch halsbrecherische Fahrten dorthin, um Sachen herauszuholen. Mit Hilfe von Soldaten schmuggelten wir uns in Truppentransporten und unter Planen von Lastwagen in die Stadt und holten aus unserem Haus, was uns wichtig erschien. Auf dem gleichen Weg verließen wir Forst - nur schwer bepackt. Eine Rückfahrt - die letzte - dauerte drei Tage. Vollkommen übermüdet, aber zufrieden sanken wir auf die Sitzbänke der 69 in Schöneweide. Dann, am Bahnhof Karlshorst - Vollalarm! Der Fahrer wollte vorschriftsmäßig sofort anhalten, damit wir alle in einem öffentlichen Luftschutzkeller Zuflucht suchen konnten, denn die Angriffe waren mörderisch. Entschlossen drängelte ich mich durch zum Fahrer und sagte hastig zu ihm: "Fahren Sie doch schnell durch Karlshorst durch. Da, wo Friedrichsfelde anfängt, gleich hinter der Brücke, stehen zwei Bunker." Der gute Mann schaltete sofort und sagte eiskalt: "Stimmt! Das mache ich!" Gesagt - getan. Mit einem Affenzahn sausten und ratterten wir durch Karlshorst. Ich trat laufend auf die Bimmel. Alle in der 69 waren einverstanden. Jeder wußte, um was es ging. Wir schafften es, und ehe ein schwerer Bombenangriff begann, befanden wir uns im sicheren Bunker.
Dann, nach dem Russeneinmarsch 1945: Wir sagten damals weder Befreiung nach Einmarsch der Roten Armee - wir berechneten die Zeit und die Weltgeschichte nur nach "vor dem Russeneinmarsch" und "nach dem Russeneinmarsch". Die 69 fuhr sehr bald wieder - jedenfalls teilweise. Nur bammelten nun regelmäßig dicke Trauben von russischen Soldaten an ihr. Als man Karlshorst größtenteils zum Sperrgebiet erklärt und die deutschen Bewohner einfach vertrieben hatte, preschte sie mit Karacho zwischen den Zäunen durch ohne anzuhalten.
Ich erinnere mich an einen Moment der Freude, der in diese Zeit fiel. Ich stand selbst in der 69 auf dem hintersten Perron und sah rückwärts aus der fahrenden Bahn. Plötzlich entdeckte ich im Sperrgebiet eine offene Kutsche mit zwei russischen Offizieren. Ich kannte sie und winkte ihnen spontan lebhaft zu. Auch sie erkannten mich und winkten freudig zurück. Ich wußte, daß es zwei Tierärzte waren. Sie hatten einige Zeit in unserer Wohnung gewohnt, während wir im Keller hausten. In dieser Zeit gewährten sie uns Schutz und Hilfe und hatten sogar nachts die umherziehenden und plündernden Horden vertrieben. Als sie bei uns im Haus lebten, wagte es kein anderer Russe, uns zu belästigen. Alle Hausbewohner dachten gern und dankbar an sie zurück. Grüßend winkten unsere Hände hin und her.
Auch 1945, im Spätsommer, stieg ich an unserer Haltestelle Triftweg aus und ging durch das Akazienwäldchen. Ich war allein. Plötzlich trat ein russischer Soldat aus dem Gebüsch und wollte mich hineinzerren. Ich fing an, laut zu schreien. Aus dem Nichts war plötzlich ein deutscher Mann da, der dem Russen mutig in die Arme fiel und ruhig in russisch auf ihn einredete. Der Russe war irgendwie ganz verdattert und ließ mich los. So schnell ich konnte, rannte ich davon. Alles war für mich gut ausgegangen. Den fremden deutschen Mann hatte ich nie vorher gesehen. - Ein paar Wochen später stieg ich wieder aus der 69 aus. Die Bahn wollte gerade weiterfahren, als ich meinen Retter am Fenster auf einem Sitzplatz entdeckte. Aufgeregt und überlaut schrie ich: "Halt! Halt!". Der Fahrer dachte wohl wunder was los ist und hielt tatsächlich wieder an. Flink kletterte ich rein in den Waggon, kämpfte mich zu dem mutigen, hilfsbereiten Menschen durch und bedankte mich bei ihm. Das war ihm furchtbar peinlich, und er wand sich wie ein Regenwurm. Aber alle Leute ringsherum klatschten ihm Beifall.
Eine lustige Geschichte fällt mir noch ein: Es war der 10.Juli 1945. Bei meiner hochschwangeren Schwester Gisela setzten die Wehen ein. Sie wollte im Oskar-Ziethen-Krankenhaus entbinden; damals nannten wir es Hubertus-Krankenhaus. Nun also sollte es losgehen. Autos oder gar Krankenwagen gab es für normale Sterbliche nicht. So blieb also nur die 69. Leider wußte man nie, was unterwegs passiert. Es gab die unmöglichsten Situationen. Die Bahn hätte liegen bleiben können, die Russen könnten sie anhalten und räumen lassen - oder sonsterwas. In dieser Zeit gab es nichts, was nicht möglich war. Mit Bauernschläue hatten wir vorgesorgt. Im Nebenhaus von uns wohnte ein Herr Irrgang, ein Kriegsverletzter aus dem Ersten Weltkrieg. Ihm fehlte ein Bein, und er kam mit der Prothese nur schlecht zurecht.
Darum besaß er einen Selbstfahrer. Wenn er darin saß, konnte er das gesunde Bein, das er noch hatte, lang ausstrecken. Das Gefährt war also ziemlich lang. Durch einen Hebel, den er mit dem rechten Arm vor- und rückwärts bewegte, also durch reine Körperkraft, konnte er den Selbstfahrer in Bewegung setzen. Die Muskeln seines Armes hatten sich mit der Zeit stark ausgebildet, und es gelang ihm, längere Strecken zu bewältigen. Dieser gute Herr Irrgang lauerte schon täglich auf die große Stunde seines Einsatzes. Nun wurde er alarmiert, und zu dritt ging es los zur Geburt meiner Nichte Gesine. Ich stieg mit meiner Schwester in die 69.
Die Mitfahrer nahmen bei jeder Wehe großen Anteil. Neben der 69 peste Herr Irrgang mit seinem Selbstfahrer. Er sollte der Retter in der Not sein, der Mann für Extremfälle. Notfalls hätten wir meine Schwester in dem Ding ins Krankenhaus schieben können. Herrn Irrgang rann der Schweiß in Strömen runter. Aber er schaffte es dranzubleiben. Blieb er wirklich mal kurzfristig zurück, holte er an den Haltestellen wieder auf, denn das Ein- und Aussteigen brauchte seine Zeit. Die ganze Besatzung der 69 zitterte am 10.Juli 1945 mit uns - aber wir schafften es. Am frohesten wird wohl Herr Irrgang gewesen sein. Ach nein - bestimmt meine Schwester.
Im Winter 1952/53 gewährte uns die gute, liebe alte 69 ihre letzten freundschaftlichen Dienste. Mein Vater bekam 1952 die Zuzugsgenehmigung für den Westen. Sein Arbeitgeber, Emil Krüger, dessen Fleischfabrik man enteignet hatte, startete im Westen einen Neubeginn. Zu dieser Zeit gab es nicht sehr viele gute Kühlfachleute wie meinen Vater, und so zog Herr Krüger ihn nach und besorgte ihm den Zuzug. Aus alter Treue folgte ihm mein Vater. Ich machte mit rüber - wie man damals sagte -, um einen Westler zu heiraten. Der Umzug brachte ungeahnte Schwierigkeiten. Die Mauer gab es zwar noch nicht, und alle Bahnen fuhren noch über die Sektorengrenzen - die S-Bahnen jedenfalls, aber Kontrollen der Volkspolizei gab es schon - und zwar reichlich. Was man nicht in den Westen mitnehmen durfte, das wurde einfach beschlagnahmt und weg war es.
Wir beschlossen trotz allem, einen geheimen Umzug zu veranstalten - und zwar mit der 69. Ein Straßenbahnfahrer guckte äußerst verwundert, als mein Vater eines Tages begann, die Eingänge und Perrons auszumessen. Dann ging es los. Die Gardinen ließen wir an den Fenstern, aber alle Möbel der Zweieinhalbzimmerwohnung wurden auseinander genommen und portioniert. Die langen und dunklen Winterabende kamen uns sehr zu passe. In mancher Nacht schafften wir zwei Touren hintereinander. Mit wenigen Freunden schleppten wir alles, was wir besaßen, in wochenlangem Einsatz in die 69 und fuhren zu verschiedenen S-Bahnstationen, um an unsere Stütz- und Lagerstellen nach Gesundbrunnen und Siemensstadt zu gelangen. Meine Eltern hatten schwere alte Eichenmöbel. Es war keine einfache Sache. Wir liefen fast auf dem Zahnfleisch, aber alles gelang wie geplant. Keiner verpfiff uns. Jeder Teelöffel kam mit und jedes Buch. Sogar mein alter Teddy aus Kindertagen, der Schrank der Franzosen und die Tüte mit den Paprikaschoten, die unter Denkmalschutz in meiner Vitrine steht, sind mit der 69 gefahren.
Eines Tages, als ich wiederkam, gab es keine 69 mehr. Andere Nummern fahren an ihrer Stelle - aber sie bleibt unvergessen. Am 2. Januar 1967 trat sie ihre letzte Fahrt an.